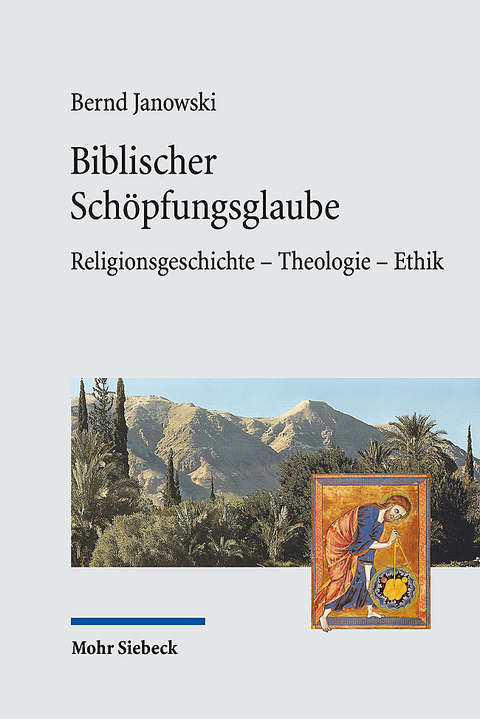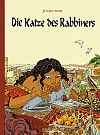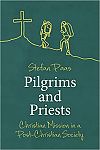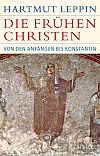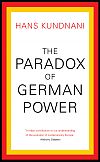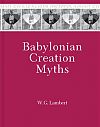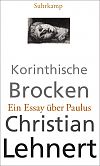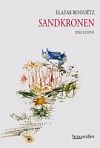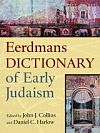Buch des Monats: Juli/August 2018

Horst Dreier
Staat ohne Gott. Religion in der säkularen Moderne.
München: C. H. Beck Verlag 2018. 256 S. Geb. EUR 26,95. ISBN 978-3-406-71871-7.
»›Staat ohne Gott‹ heißt nicht: Welt ohne Gott, auch nicht: Gesellschaft ohne Gott, und schon gar nicht: Mensch ohne Gott.« (7) So beginnt das jüngste Buch des Würzburger Ordinarius für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht. Die ersten vier Kapitel umfassen die Vortrags-reihe »Herausforderungen des säkularen Verfassungsstaates«, die Dreier als Hans-Blumenberg-Gastprofessor im Wintersemester 2016/17 an der Universität Münster gehalten hat. Zur Sprache kommen »Facetten der Säkularisierung« (Kap. 1), »Eine kurze Verfassungsgeschichte der Religionsfreiheit in Deutschland« (Kap. 2), »Die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates – Konzeption, Kritik, Kontroversen« (Kap. 3) und »Sakrale Elemente im säkularen Staat?« (Kap. 4). Ergänzt und vertieft werden diese Überlegungen durch eine pointierte Analyse der Präambel des Grundgesetzes »Der Präambel-Gott« (Kap. 5) und eine kritische Diskussion des vielzitierten Böckenförde-Diktums »Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann« in einem abschließenden Kapitel »Das Böckenförde-Diktum: Erfolgsgeschichte einer Problemanzeige« (Kap. 6).
Das klar, historisch informiert und engagiert argumentierende Buch beansprucht trotz seines provozierenden Titels ausdrücklich, »keine Streitschrift, sondern eine Analyse« (10) zu sein. Die Pointe dieser Analyse ist der Nachweis, dass im freiheitlichen Verfassungsstaat »die Autorität des Rechts von der Autorität eines bestimmten Glaubens oder einer bestimmten Weltanschauung abgekoppelt ist« (10). Das heißt umgekehrt, dass »die säkulare Grundrechtsdemokratie des Grundgesetzes mit jedweder Form eines Gottesstaates, einer Theokratie, einer sakralen Ordnung oder eines christlichen Staates gänzlich unvereinbar ist« (10). Man sieht schnell, warum sich das in der Gegenwart und nicht nur in Bayern keineswegs von selbst versteht. Insofern ist sein Buch eine kritische Erinnerung zur rechten Zeit. Dreier lässt keinen Zweifel daran, dass der moderne Verfassungsstaat »keine sinnstiftende Instanz« ist (11), dass er »Frieden stiften und Freiheit gewährleisten, Wohlfahrt und Ordnung garantieren und das Miteinander des Menschen auf eine allseits verträgliche Weise organisieren« soll (11). Aber er hat keine Sinnstiftungsaufgabe, ist nicht Hüter eines Heilsplans, legitimiert sich nicht religiös und gründet seine Legitimität nicht auf Gott, sondern auf das Prinzip der Volkssouveränität, das Dreier nicht metaphysisch oder sakral versteht, sondern funktional-pragmatisch als »Wille [...] der zum Staatsvolk zusammengefaßten Individuen« (11).
Man kann darüber streiten, ob diese Argumentation die Bedeutung der stets partikularen Geschichte für das Selbstverständnis der Menschen hinreichend berücksichtigt. Aber es ist eben die Pointe moderner Verfassungen, dass sie das historisch Gewordene in eine legitime Ordnung überführen wollen, die sich mit universalen Vernunftargumenten und nicht mit partikularen Erzählungen legitimiert. Deshalb betont Dreier zu Recht: Der säkulare Staat ist weder antireligiös noch proreligiös. Er »befindet sich in einem Verhältnis der Äquidistanz zu allen religiösen und weltanschaulichen Positionen, nicht in einer Oppositionshaltung zu ihnen« (12). Er ist neutral, und diese Neutralität »resümiert nicht fortschreitenden religiösen und konfessionellen Indifferentismus« (12), wie schon Hermann Lübbe betont hatte, sondern markiert die kritische Selbstzurücknahme des Staates angesichts letzter Lebensentscheidungen. Weltanschauungen und Religionen werden nicht bekämpft, bestritten oder verdrängt, sondern es wird ihnen durch die gewollte Neutralität des Staates gerade ermöglicht, sich im Rahmen der Ordnung des Grundgesetzes in der Gesellschaft frei zu entfalten. Das Plädoyer für einen Staat ohne Gott ist deshalb zugleich ein Plädoyer für eine Gesellschaft, in der um Gott öffentlich gestritten werden kann. Die Neutralität, die für den Staat gilt, kann für die Gesellschaft gerade nicht gelten. Sie muss der Ort sein, an dem Streit über Wertüberzeugungen möglich ist. Und die Funktion des Rechtes ist es nicht zuletzt, eben das zu ermöglichen.
Dreiers These ist nicht neu, aber sie wird von ihm klar und mit treffenden Argumenten entfaltet und gegenüber mannigfachen gegenläufigen Tendenzen in der Gegenwart pointiert zur Geltung gebracht. Aufgrund dieser Tendenzen wird das, was als Analyse angelegt ist, dann aber doch immer wieder auch zu einer Streitschrift – einer Streitschrift für das, was sich eigentlich von selbst verstehen sollte, aber häufig nicht (mehr) tut. Das wird an vielen Punkten dieses umsichtig argumentierenden Buches deutlich, besonders in Dreiers Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Auffassungen einer »Sakralisierung des Rechts« in Kapitel 4. Dreier zerpflückt die dafür angeführten Argumente von Willoweit (149 ff.), Haltern (153 ff.) und Joas (157 ff.) Punkt für Punkt. Besonders Joas’ Überlegungen zu einem Prozess der Sakralisierung der Person werden von ihm kritisch beurteilt. Hätte Joas die Menschenwürde als eine »Form oder Gestalt der Sakralität« entfaltet, hätte Dreier dem vielleicht noch etwas Positives abgewinnen können (158). Doch Joas redet nicht von Menschenwürde, sondern von Menschenrechten, und eine »neue Genealogie der Menschenrechte« basierend auf affektiven Wertüberzeugungen kann Dreier nirgendwo erkennen (158–166). »Die Überwältigung durch Gefühle ist kein guter Ratgeber und schon gar kein sicherer Führer auf dem Weg zu den Grundrechten.« (166) Subjektive Evidenz und affektive Intensität kennzeichnen auch »den mentalen Zustand eines Lynchmobs« (166). Dreiers Resümee ist daher unmissverständlich: »Die Sakralitätsidee geht am Wesen der Menschenrechte vorbei, weil der Status der Affirmation unklar ist; auf Merkmale subjektiver Evidenz und affektiver Intensität sollte man bei der Entfaltung und Durchsetzung der Menschenrechte besser verzichten.« (166). Joas’ These unterschätzt die Ambivalenz kollektiver Werthaltungen. Der moderne Verfassungsstaat »bedarf keiner sakralen Aura und keines Mythos. Er ist ein Geschöpf rationalen Denkens und Handelns« und kann – wie Dreier mit Isensee formuliert – auf »pseudoreligiöse Überhöhungen und pseudotheologische Deduktionen schadlos verzichten« (168) – und auf religiöse und theologische auch.
Es drängt sich auf, das an der Präambel des Grundgesetzes zu überprüfen. Dreiers Analyse ist historisch informiert, argumentativ klar und systematisch eindeutig: Es handelt sich »beim Gottesbezug der GG-Präambel um eine Demutsformel«, nicht um »eine transzendente Überhöhung der Verfassung« (183). Mit dieser Formel wird dem »Absolutheits- und Wahrheitsanspruch totalitärer Staatsmodelle jedweder Provenienz« eine Absage erteilt (183). Es wird aber – anders als bei manchen Landesverfassungen – keine positive Begründung staatlicher Souveränität im Gottesbezug vorgenommen. Die Verfassung ergeht »nicht im Namen Gottes; die Präambel bedeute[t] weder eine Verpflichtung des Einzelnen auf das Christentum noch charakterisier[t] sie die Bundesrepublik Deutschland als christlichen Staat« (188). Aus der Präambelformel lassen sich weder irgendwelche religiösen Staatsziele ableiten (etwa die Erziehung zur »Ehrfurcht vor Gott«), noch wird die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates in irgend¬einer Weise eingeschränkt. Faktisch folgt Dreiers Argumentation hier der kritischen Einsicht Kants, dass die Vernunft kein Instrument zur Wahrheitserkenntnis, sondern allenfalls zur Irrtumsverhinderung ist (KrV B 823): Die Gottesformel der Präambel eröffnet keinen positiven Transzendenzbezug, sondern erteilt allen falschen Absolutheitsanmaßungen eine Absage.
Dreier konkretisiert dies abschließend in einer differenzierten Diskussion des Böckenförde-Diktums. Die vielzitierte Formel wird in ihrer Genese historisch kontextualisiert, ihre vielfältigen Interpretationen kritisch gesichtet und ihre Pointe klar herausgearbeitet: »Wenn komplexe Gesellschaften und politische Gemeinwesen auf Dauer bestehen sollen, müssen sie auf mehr bauen können als auf das reibungslose Funktionieren ihrer administrativen Organisationsstrukturen und die liberalen Freiheitsgarantieren für ihre Bürger.« (213) Dieses »Mehr« muss keineswegs ein Wertekonsens sein, auf den sich alle verständigen müssen. Mit Recht betont Dreier, dass nicht »vager Konsens, sondern wohlgeordneter Dissens« das Programm sein könnte: »Integrativ kann eben auch der friedliche Streit der Meinungen wirken.« (214) Frei ist nur – wie Kant wusste –, wer seine Freiheit auch gebraucht und in Anspruch nimmt. Eine freiheitliche Verfassung muss Selbstdenken und Selbsthandeln nicht nur ermöglichen, sondern sie hat auch nur Bestand, wo das konkret geschieht. Das aber führt nicht zwangsläufig zu Konsens, sondern in der Regel zu Dissens.
Dass es im modernen Verfassungsstaat nicht darum geht, alle auf denselben Wertekanon zu verpflichten, sondern gerade umgekehrt darum, das friedliche Zusammenleben von Personen mit divergierenden Wertüberzeugungen zu ermöglichen, sollte in den Debatten um eine »Leitkultur« nicht vergessen werden. Voraussetzung eines funktionierenden Staates ist nicht ein für alle verbindlicher Wertekonsens, sondern der friedliche Streit um Werte und Überzeugungen. Andersdenken muss möglich sein, und anders handeln und leben auch. Dreiers Buch ist ein engagiertes Plädoyer für die demokratietheoretisch grundlegende Einsicht: Ein Rechtsstaat fordert keine Wertekonsense ein, sondern ermöglicht friedliches Zusammenleben trotz Wertedissensen.
Das setzt ein klares Bewusstsein für die Differenz zwischen Staat und Gesellschaft voraus. Dass der Staat neutral ist, heißt nicht, dass die Gesellschaft das auch sein müsste. Der Staat kann nur neutral sein, wenn die Gesellschaft kein Ort religiös-weltanschaulicher Indifferenz ist, sondern ein Ort des Gebrauchs der eigenen Freiheit in öffentlichen Debatten über divergierende Wertüberzeugungen. Soll die unverzichtbare Neutralität des Staates nicht untergraben werden, darf in gesellschaftlichen Debatten gerade nicht auf Neutralität und Indifferenz gedrängt und Konsens eingefordert werden. Man muss sagen können und sagen, was man aus welchen Gründen für akzeptabel hält und was nicht – auch in Fragen der Religionen und Weltanschauungen. Wenn wir nicht mehr zu sagen wagen, dass bestimmte Religionen noch problematischer sind als andere und manche Religionen weniger fragwürdig als andere, unterminieren wir das Funktionieren unserer Gesellschaft. In diesem Sinn schließt Dreiers Diskussion des Böckenförde-Diktums mit Recht: »Das Diktum ist ein Weckruf, ein Aufruf, ein Mahnruf. Wir sollten ihn nicht überhören.« (214) Aber eben kein Mahnruf zum Konsens über einen für alle verbindlichen Wertekanon, sondern ein Weckruf zum öffentlichen Streit über das, was es heißt, auf menschliche Weise zusammen zu leben. Wir werden nicht einer Meinung sein, aber der Streit über diese Differenzen ist der Motor dafür, die Schwächen und die Stärken der eigenen Überzeugungen kritisch zu prüfen und eben so die Freiheit zu praktizieren, ohne die es kein verantwortliches Zusammenleben in der Gesellschaft eines freiheitlichen Verfassungsstaats gibt.
Ingolf U. Dalferth (Claremont)