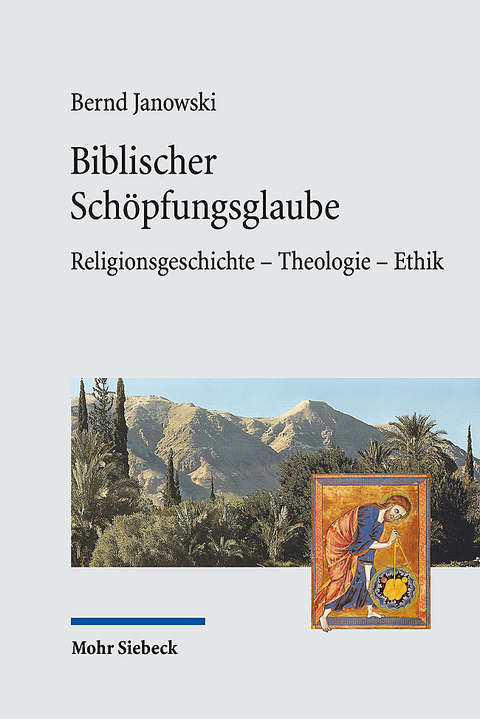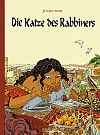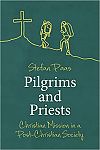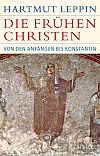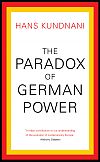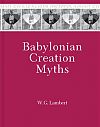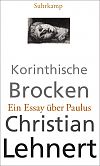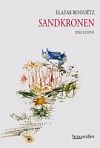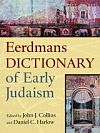Buch des Monats: Mai 2015
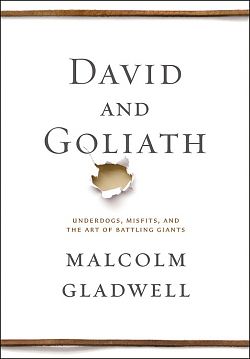
Gladwell, Malcolm
David and Goliath. Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants.
New York u. a.: Little, Brown and Company 2013. 320 S. Geb. ISBN 978-0-316-20436-1
Nach “The outliers” und “Blink” ist „David and Goliath“ der dritte New York Times Bestseller, den der englisch-kanadische Autor und staff writer des New Yorker, Malcom Gladwell, vorzulegen vermag.
Gladwell wählt als Sachbuchautor wie gewohnt den Zugang mit einer sehr alten Sachfrage, die angesichts aktueller politischer und ökonomischer Krisen aktueller kaum sein könnte und die der Autor exegetisch umrahmt: Wie macht man Stärken zu Schwächen? Wie gewinnen scheinbar Schwächere in Situationen, in denen sie eigentlich verlieren sollten? So schreibt Gladwell: „David’s victory was improbable and miraculous. He shouldn’t have won. Or should he have.“
Mit einer alttestamentlichen Exegese einleitend referiert Gladwell die Auslegungen des Kampfes zwischen David und Goliath, um sich vor allem der These zuzuwenden, dass Goliath aufgrund seiner Sehschärfe den Kampf verliert. In dieser Lesart interpretiert Gladwell 1. Samuel 17: 41Und der Philister ging auch einher und machte sich zu David und sein Schildträger vor ihm her. 42 Da nun der Philister sah und schaute David an, verachtete er ihn; denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. 43Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, daß du mit Stecken zu mir kommst? und fluchte dem David bei seinem Gott 44und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch geben den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auf dem Felde!“
Warum braucht Goliath einen eigenen Schildträger, der ihn aufs Schlachtfeld führt? Und warum sagt er als der Stärkere zu David: „Komm her zu mir?“ statt seinem schwächeren Gegner entgegenzulaufen und ihn auf offenem Feld konventionell zu besiegen?
Ohne sich als Alttestamentler oder Mediziner zu gerieren, wählt Gladwell für das Kernargument seines eigenen Buches folgende Interpretation: Goliath braucht einen Schildträger, der ihn zu David führt, weil er unscharf sieht. Darum eilt er auch nicht, wie erwartbar – weil strategisch günstiger – David entgegen, sondern ruft „Komm her zu mir.“ Davids so erfolgreiche Kampfeslist mit der Steinschleuder funktioniere nur deshalb, weil Goliath viel zu spät merke, wie er von David angegriffen wird. Zudem spekuliert Gladwell, dass Goliath deshalb so groß sei und unscharf sehe, weil er womöglich an Akromegalie leide, ausgelöst durch einen Tumor, der die Hormonproduktion des Giganten anregte.
Gladwell belässt es hier bei dem Versuch der exegetisch-medizinischen Unterlegung seines Buchtitels, weil er am Sieg des kleinen David gegen den übermächtigen Goliath vielmehr ein Muster herausarbeiten will, dass ihm an diesem Kampf Klein gegen Groß auffällt: Die Stärken des Starken werden am Ende zu eben jenen Schwächen, an denen der Starke unerwartet scheitert – in Goliaths Fall seine Unbeweglichkeit bedingt durch seine Größe.
Wie in Gladwells anderen Büchern unterlegt er in der Folge sein scheinbar simples Kernargument mit individualisierten Rekursen auf Historie und Psychologie, Sport und Bildung. Einige von diesen sind so lehrreich bis kurios, dass es Gladwells Werke für jene lesenswert macht, die sich aktuell mit der Frage beschäftigen, wer in der Eurokrise oder im Bildungswesen, in der Ökumene oder im Gesundheitswesen eigentlich der Starke und wer der vermeintlich Schwache ist und was dies strategisch wie ethisch bedeuten kann.
So traktiert der Autor sein „underdog wins“-Argument im Rückgriff auf die militärischen Forschungen des Politikwissenschaftlers Ivan Arreguin-Toft (S. 22). Dieser untersuchte für die zurückliegenden 200 Jahre die Kriege zwischen großen Ländern und jenen, die mindestens zehnmal kleiner waren. Erwartbar gewesen wäre, dass die Großen fast immer gewinnen, was aber statistisch nur in erstaunlich niedrigen 71,5% der Fälle zutraf. Toft untersuchte dann, was passiert, wenn die kleineren Länder nicht wie Goliath in der Fläche die vom Stärkeren erwarteten Schlachten kämpften, sondern zu asymmetrisch-unkonventionellen Taktiken wie etwa den Guerillakrieg übergingen.
Das Ergebnis: Die bereits erstaunlich hohe Erfolgsquote der Davids von 28.5% stieg auf 63,6%. Wenn man annimmt, dass die Bevölkerungszahl der USA zehnmal höher ist als die Kanadas, würde das bedeuten, dass die Siegchancen der Kanadier zumindest statisch in einem Kriegsfall über 50% lägen. Derlei Beispiele unterlegt Gladwell dann mit den unwahrscheinlichen Siegen eines Lawrence von Arabien und den Gründen für diese Siege. Wer sich etwa mit dem Nahen und Mittleren Osten beschäftigt, der wird in der Folge potentielle Kriegsszenarien identifizieren, bei denen sich die Chancen für den scheinbar Schwächeren dann auch deutlich signifikanter zu dessen Gunsten verschieben, als im Fall Kanada-Vereinigte Staaten.
Im Folgenden wählt er der Autor dann ähnliche, nur scheinbar paradoxe Exkurse im Bereich Bildungswesen oder Sport, wenn er Gründe sucht, warum Schüler in großen Klassen genauso oder besser lernen als in kleinen (S. 42ff.) oder wie ein Team trotz hoffnungslos unterlegener Einzelspieler Junior-Basketballmeister wurde. Bei all dem erhebt Gladwell keinen pädagogischen oder sportwissenschaft¬lichen Anspruch auf die Validität seiner Analyse, sondern er leistet das, was alle seine Bestseller zu eben solchen gemacht hat:
Er identifiziert einprägsame Beispiele als Beleg einer These, die nur im ersten Moment unwahrscheinlich scheint, aber in der Folge viele Unwahrscheinlichkeiten in Politik, Wirtschaft oder – wie im Fall David gegen Goliaths – antiker Militärgeschichte rational zu erklären und vor allem daraus zu lernen hilft: Bei genauerer Analyse hatte David von Anfang an die deutlich besseren Karten, sofern er bereit war, seine Strategie und Taktik den Schwächen eines nur scheinbar übermächtigen Gegners anzupassen.
Nils Ole Oermann