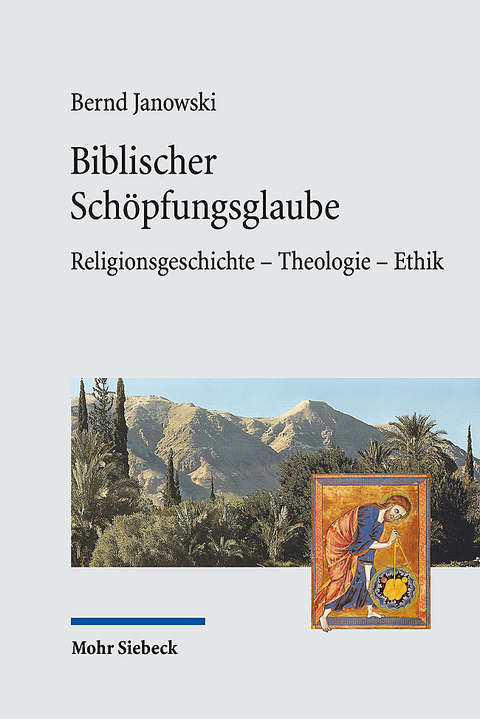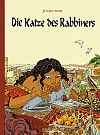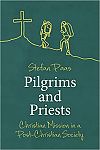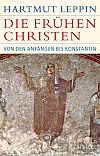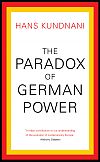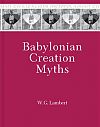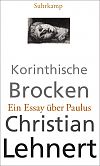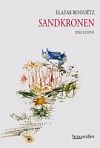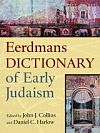Buch des Monats: Mai 2014
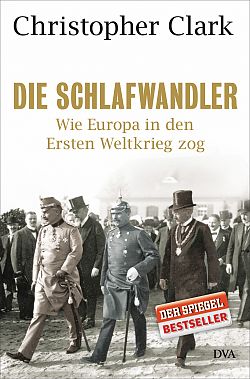
Clark, Christopher
Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog.
München: Deutsche Verlagsanstalt 2013. 896 S. EUR 39,99. ISBN 978-3-421-04359-7 (The Sleepwalkers. How Europe Went to War 1914. London: Allen Lane, 2012).
Der Name des Autors verspricht in bester Tradition englischer Geschichtsschreibung, was in der historischen Zunft in Deutschland längere Zeit verpönt war: Ergebnisse gründlichster Quellenrecherche, diese aber in hinreißender Form spannend erzählt. Christopher Clark, Professor für Neuere Europäische Geschichte am St. Catherine’s College in Cambridge, hat so schon über Kaiser Wilhelm II. geschrieben und über Preußen zwischen 1600 und 1947. Pünktlich zum Jahrestag des Ausbruchs eines Krieges, der bei uns der erste in einer Reihe von zwei Weltkriegen ist und anderswo als „der große Krieg“ vermutlich präziser in seiner überaus fatalen und traumatischen Wirkung für die Weltgeschichte im zwanzigsten Jahrhundert beschrieben ist, ist aus der Feder von Clark ein Buch zum Thema erschienen. Das Buch endet nach siebenhundert Seiten bei den „Generalmobilmachungen, Ulimaten und Kriegserklärungen“. Vorher wird, nach einzelnen Ländern geordnet, die Lage im Land beschrieben und vor allem die außenpolitische Orientierung samt ausführlicher Antwort auf die Frage, wer für sie verantwortlich war. Dieser Zugriff auf die Materie führt dazu, dass die Ereignisse des 28. Juni 1914, also der fatale Besuch des Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gattin in Sarajevo, erst in der Buchmitte (475–518) erzählt werden. Immer wieder gelingen Clark trefflichste Charakterisierungen der handelnden Persönlichkeiten; der deutsche Kaiser heißt einmal „die Nervensäge im Club“ (245). Das dicke Buch liest sich in einem Zug. „Chapeau“ ruft ein Rezensent auch entsprechend ohne viel Federlesens aus (Lothar Machtan, Sehepunkte 14, 2014; http://www.sehepunkte.de/2014/01/23681.html).
Thema und Erscheinungszeitpunkt bringen es mit sich, dass das Buch und seine Thesen bereits ausführlich in der historiographischen Zunft diskutiert wurden, zumal es nur eines von drei „Dickleibern“ ist, die gerade die Feuilletons beschäftigen – Herfried Münkler und Jörn Leonhard konkurrieren mit Clark um die Aufmerksamkeit des gebildeten Publikums. Was bleibt in einer „Theologischen Literaturzeitung“ also noch über Clark zu bemerken? Beginnen wir für die Antwort, wie es sich gehört, ganz vorn. Wenn man das Buch zur Hand nimmt, leuchtet einem auf dem Schutzumschlag eine Gruppe von drei Personen entgegen, die energischen Schrittes über einen Sandboden schreiten. Es handelt sich um eine Aufnahme, die 1912 bei der Einweihung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie in Berlin-Dahlem gemacht wurde, und die drei Herren waren Kaiser Wilhelm II., dessen Leibarzt Friedrich von Ilberg und der Berliner Kirchenhistoriker Adolf von Harnack, Präsident der damals noch Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft genannten heutigen Max-Planck-Gesellschaft. Das Bild des Schutzumschlages selbst spielt keinerlei Rolle im Buch (was an und für sich nicht ungewöhnlich ist), Harnack wird weder in der Legende erwähnt noch sonstwo in der voluminösen Monographie. Dabei gehörte Harnack doch zu den Unterstützern des im September 1914 veröffentlichten „Aufrufs an die Kulturwelt“, in dem eine deutsche Kriegsschuld bestritten sowie die Verletzung der Neutralität Belgiens ebenso wie die Zerstörungen im belgischen Löwen bagatellisiert wurden – obwohl Harnack den Text des Aufrufs nicht kannte, warb er in einem Telegramm gemeinsam mit Emil Fischer und Gustav von Schmoller bei den Intellektuellen des Reichs dafür, ihn zu unterschreiben. Erst 1919 distanzierte er sich in einem offenen Brief an Clemenceau von einzelnen Sätzen des Textes. Mindestens in seiner anfänglichen Zustimmung stand Harnack repräsentativ für viele seiner Universitäts-Kollegen im Kaiserreich. Dieses Defizit eines von vielen anderen bereits hymnisch gelobten und auch wirklich in vielen Details meisterlichen Buches, mit Harnack einen der einflussreichen Protestanten auf dem Titel abzubilden, aber im Werk nicht zu behandeln, ist freilich symptomatisch: Clark beschreibt ausführlich in den beiden Eröffnungskapiteln die Lage in Serbien und in der habsburgischen Doppelmonarchie, aber er verzichtet auch hier darauf, Religion und Theologie in der Ausführlichkeit darzustellen, in der sie dargestellt gehören. Natürlich erfährt man, dass es beim Balkan-Konflikt um römisch-katholische, orthodoxe und muslimische Bevölkerungsteile geht, aber wie es sich genau verhält, wie diese drei Großgruppen in sich differenziert waren und welche Rolle beispielsweise wichtige Figuren der serbisch-orthodoxen Kirche in den Debatten um ein Groß-Serbien spielten, das liest man nicht. Dabei macht gerade die große Sorgfalt, mit der Clark die durchaus heftigen Debatten um den Umgang mit der habsburgischen Doppelmonarchie in Serbien schildert, Appetit darauf zu erfahren, ob die serbisch-orthodoxe Kirche tatsächlich so monolithisch agierte, wie man als Dilettant und aufgrund oberflächlicher Eindrücke aus jüngster Vergangenheit zu vermuten geneigt ist.
Religion und Theologie sind aber nicht nur von Bedeutung, wenn man versucht, die Ereignisse im Sommer 1914 zu verstehen; immer wieder spielen solche Zusammenhänge auch in die Geschichte der Erforschung dieser Ereignisse herein: Das Bild des Berliner Großordinarius Harnack auf dem Titelbild des Schutzumschlages erinnert mindestens den rezensierenden Berliner Kirchenhistoriker noch an einen anderen für die Thematik einschlägigen Berliner Kirchenhistoriker, der sich freilich nach virtuosem Auftakt bald aus dem Fach verabschiedete – so nachhaltig verabschiedete, dass nur noch Fachleute wissen, dass der Betreffende sein Handwerk bei Erich Seeberg gelernt hatte (dessen Positionen schon deswegen die Auseinandersetzung lohnen, weil sie – ähnlich wie bei dem gleichfalls tief nationalsozialistisch kontaminierten Emanuel Hirsch – gegenwärtig in der evangelischen Theologie teilweise fröhliche Urständ feiern, beispielsweise in der Lutherforschung). Gemeint ist Fritz Fischer, der Urheber der sogenannten Fischer-Kontroverse über den deutschen Anteil am Ausbruch des ersten Weltkriegs. Fischers in damaligen Augen radikale Position zur Frage, ob Deutschland den Weltkrieg verschuldet habe, kann man ohne eine Analyse der Prägung dieses Historikers durch die sehr spezifische Form der Geschichtstheologie Erich Seebergs eigentlich gar nicht verstehen. Die heftige Kontroverse brach 1961 aus, als Fischer sein Buch „Griff nach der Weltmacht“ veröffentlichte; sein Hauptgegner in Auseinandersetzungen war pikanterweise Gerhard Ritter – die Kontroverse gab also einem ehemaligen NSDAP- und SA-Mitglied und Anhänger der „Deutschen Christen“ Gelegenheit, sich als links-liberal zu profilieren und gleichzeitig einen der überlebenden Widerstandskämpfer aus dem Freiburger Kreis und engagiertes Mitglied der „Bekennenden Kirche“ als „Ultrarechten“ zu demaskieren.
Clark erwähnt alle diese Zusammenhänge nicht. Er schreibt mehr implizit als explizit im Buch gegen das an, was er eine „entschärfte Version der Fischer-These“ nennt, die seiner Ansicht nach „noch heute die Studien von Deutschlands Weg in den Krieg“ dominiert (715). Offenbar meint Clark damit weniger, dass man mit Fischer den Zeigefinger darauf legt, dass Mächte wie Deutschland nicht einfach in den Krieg „hineingeschlittert“ sind, sondern den Kriegsausbruch aktiv beförderten. Vielmehr geht es Clark bei seiner Polemik gegen Fischer um eine Geschichtsbetrachtung, „die sich in erster Linie mit der Schuldfrage belastet“ (716). Diese Polemik verwundert, weil unklar bleibt, gegen wen sie sich richtet – natürlich ist selbst denen, die sich mit der Frage der Schuld in der Geschichte beschäftigt haben, deutlich, dass zwischen historiographischer Analyse, der Beschreibung von (unter Umständen kausaler) Verantwortung und der Identifikation von moralischer Schuld streng unterschieden werden muss; ein Blick in die Historik von Droysen genügt eigentlich dafür. Das Problem ist hier – wie auch sonst oft – weniger eine nicht genügend ausdifferenzierte Theorie, als vielmehr eine nicht genügend differenzierende Praxis. Das gilt natürlich auch für die Frage, wer „die Schuld“ am Ausbruch des Weltkrieges „trägt“: Um zu verstehen oder mindestens zu ahnen, warum die Fischer-Kontroverse durch die Verwendung der Kategorie „Schuld“ so moralisch aufgeladen war, muss man die Biographie der beiden Haupt-Protagonisten näher in den Blick nehmen und darf nicht einfach wie Clark ohne weitere Erläuterung gegen jegliche moralische Wertung in der Geschichtswissenschaft polemisieren. Da beide Protagonisten schon aus rein biographischen Gründen an der Frage nach deutscher Schuld interessiert waren, betrachteten sie die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts auch durch diese biographisch bedingte Brille. Die schlichte Tatsache aber, dass die Fischer-Kontroverse moralisch hoch aufgeladen war, entwertet natürlich auch die Argumente Fischers nicht vollkommen. Denn die Diskussion über diese Argumente hat nicht nur eine neue Aufmerksamkeit für „den massiven deutschen Verursachungsanteil an der fatalen Konstellation, die zum Krieg geführt hat“ (Hans-Ulrich Wehler, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. Mai 2014, S. 10), ermöglicht, die sich heutigentags an vielen Punkten von der Sicht Fischers unterscheidet. Sie hat inzwischen die einstige hohe moralische Aufladung der Kontroverse vollkommen hinter sich gelassen, so dass man nicht recht versteht, wogegen Clark eigentlich polemisiert. Die einstige säkularisierte Geschichtstheologie (so der treffende Begriff von Heinrich August Winkler) des Inhalts, dass Deutschland mit der Teilung für seine Schuld in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zu büßen hatte, prägt doch nun wirklich seit längeren keine ernstzunehmende Untersuchungen zu den Kriegsursachen des ersten Weltkriegs mehr.
Zunächst einmal geht es ja bei einer Untersuchung der Ereignisse des Sommers 1914 samt ihrer Vorgeschichte auch tatsächlich gar nicht um Schuld, sondern um die jeweiligen massiven nationalen Verantwortungsanteile an dem Kriegsausbruch. Die Interessen derer, denen aus unterschiedlichsten Gründen an einer schnellen Kriegsentscheidung gelegen war, kann man nicht als eine „Art Paranoia“ abtun und darauf hinweisen, dass es Menschen, die „unter einer Art Paranoia litten“, nicht nur in Deutschland gab (717). Nicht wenige, die in Berlin handelten, wussten genau, was sie taten und hielten das für ein gerade noch kalkulierbares Risiko. Angesichts der Tatsache, wie energisch Clark die brandgefährliche „Balkanisierung“ des russisch-französischen Bündnisses in den Mittelpunkt rückt, die entlang der österreichisch-serbischen Grenze eine „geopolitische Zündschnur“ gelegt habe, die das Pulverfass schließlich zur Explosion brachte, fällt auf, wie verständnisvoll der Autor über die deutsche Politik urteilt. Kaiser Wilhelm ist eine „Nervensäge“ und verhält sich „wie ein aufgeregter Teenager“ – ja, gewiss agierte der Monarch so, aber doch mit überaus fatalen Folgen, die durch solche Wortwahl eher verdeckt werden. Er ist zudem einer der wenigen von den vielen im Buch beschriebenen Akteuren, bei dem man sich fragen kann, ob die Kategorie psychischer Krankheiten wie einer Paranoia zum Verständnis der Persönlichkeit hilft. Und Wilhelms Ministerialen wie Militärs waren mehr als Schlafwandler, sie wussten – wie das Beispiel Bethmann-Hollweg zeigt – über das hohe Risiko ihres Blankoschecks für Österreich-Ungarn sehr wohl Bescheid.
Man kann es also schärfer formulieren: Dem Buch fehlt eine ausführliche Analyse der Lage in Deutschland und auch deswegen hängt die mehr implizite, erst am Schluss explizit gemachte Abweisung jeder Position in den Bahnen Fritz Fischers merkwürdig in der Luft. Das liegt nicht nur daran, dass die Historisierung der Fischer-Kontroverse unterbleibt (und zur Historisierung zählt, wie gesagt, notwendigerweise die Analyse der Prägung Fischers durch Seeberg, wie sie beispielsweise Klaus Große Kracht vorgenommen hat), sondern dass die einleitenden Kapitel mit ihren brillanten Analysen zur Lage sich auf Serbien und Österreich-Ungarn beschränken. Das deutsche Reich kommt als „imperialer Nachzügler“ tatsächlich erst wie ein Nachzügler und spät (194-208) in den Blick. Man erfährt allerlei über die peinlichen rhetorischen Eskapaden des deutschen Kaisers, aber zu wenig über Bethmann-Hollweg, Eulenburg, Holstein und Bülow, über von Moltke, Tirpitz et tutti quanti. Wenn spät im Buch die Zwickmühle des Reichskanzlers Bethmann-Hollweg geschildert wird, Österreich-Ungarn im Bündnisfall eigentlich nur beispringen zu können, weil die andere Option als Verrat gewertet werden müsste, eben dadurch aber auch einen gefährlichen Kriegskurs zu unterstützen (533–538), ist in den voraufgehenden Kapiteln nicht vorbereitet und daher nicht wirklich klar, wer im Reichskanzlerpalais, dem Auswärtigen Amt und den anderen Gebäuden der Berliner Wilhelmstraße wie agiert, wenn der Kaiser gerade einmal da ist oder eben auch nicht. Dabei findet sich das einschlägige Material anderswo vorzüglich aufbereitet, beispielsweise in der anderen großen, dreibändigen Biographie Kaiser Wilhelms, die gleichfalls ein englischer Historiker verfasst hat: John C. G. Röhl.
Es mag ein wenig abgeschmackt sein, wenn ein Kirchenhistoriker an einem – wie gesagt – meisterlich erzählten Buch auf einer Basis überaus gründlicher Quellenarbeit kritisiert, dass es nicht an den Schwerpunkten orientiert ist, die er schon aufgrund seiner Fachdefinition zu setzen pflegt. Aber es geht hier nicht um den üblichen, an den Usancen der eigenen Disziplin orientierten besserwisserischen Einwurf „Ich hätte das anders geschrieben“. Denn es gibt nur wenige, die gegenwärtig überhaupt ein solches Buch wie Clark schreiben können, weil nur wenige über eine derart stupende Quellenkenntnis verfügen und doch auch über die notwendige methodische Klarheit (die quellenkritischen Bemerkungen in der Einleitung, 9–18 sind vorzüglich) wie erzählerische Kompetenz. Aber es fragt sich, ob wir nicht endlich auch noch einmal ein Buch brauchen, das über die üblichen Darstellungen zur Rolle der Kirchen in ersten Weltkrieg, über die Präsentation der schrecklichen kriegstrunkenen Texte der vielen einen und der zart friedensbewegten Texte der wenigen anderen die Rolle von Religion und Theologie im Vorfeld des 28. Juni 1914 vergleichend und kritisch analysiert, europäische Religionsgeschichte statt rein deutscher Kirchengeschichte betreibt. Von Clark war das vermutlich auch nicht zu erwarten. Aber nicht nur der Harnack auf dem Schutzumschlag verstärkt den Erwartungsdruck, der in den nächsten Wochen und Monaten auf denen liegt, die in den Disziplinen der Kirchen- und Religionsgeschichte tätig sind. Und das letzte Wort zur fatalen Rolle der deutschen Politiker und Militärs in den Sommermonaten 1914 ist mit Clark auch noch nicht gesprochen.
Auf nahezu jeder Seite dieses wichtigen Buches wird deutlich, dass es auf allen Seiten Politiker und Militärs gab, die den Krieg wollten, weil sie ihn unter Berufung auf durchaus rationale Argumente für unausweichlich, im Sommer 1914 aber auch noch für gewinnbar hielten. Solche Menschen wird man nur in einem sehr übertragenen Sinne „Schlafwandler“ nennen dürfen, wie es bereits im nicht sehr glücklichen Titel des Werks geschieht. Clark erklärt den Begriff so, dass man schließlich doch einigermaßen versteht, warum er ihn verwendet (718): „wachsam, aber blind, von Alpträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen sollten“. Ob diese wahrscheinlich zutreffende Perspektive auf die handelnden Menschen aber nicht vielleicht doch, wenn alle historische und historiographische Arbeit getan ist, eine Debatte über individuelle wie kollektive Schuld und Verhängnis nahelegt und ein Ansatzpunkt für eine theologisch orientierte Geschichtsschreibung wäre, die die klassischen Fallen säkularisierter und nicht-säkularisierter Geschichtstheologie vermeidet?
Christoph Markschies (Berlin)