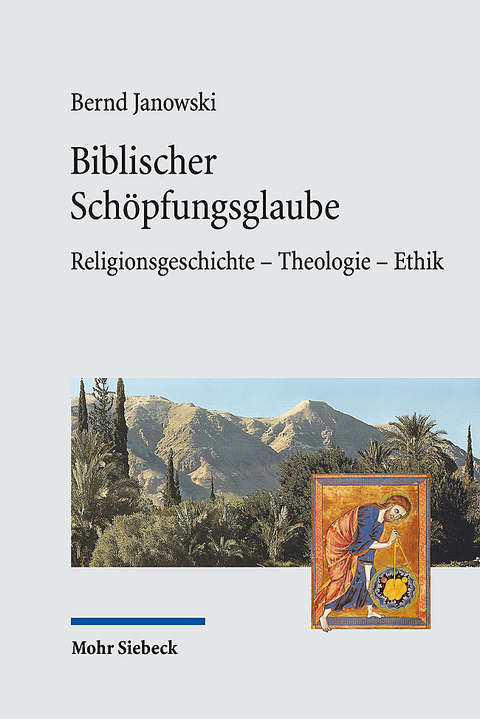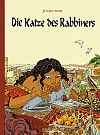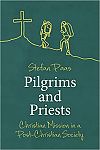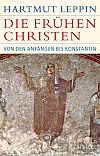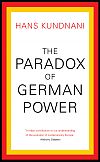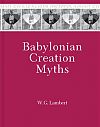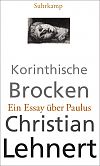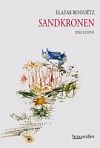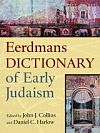Buch des Monats: April 2023

Steidele, Angela
Aufklärung. Ein Roman
Berlin: Insel Verlag Anton Kippenberg 2022. 603 S. Geb. EUR 25,00. ISBN 9783458643401.
Dieses Buch ist ein Hybrid. Das wird bereits aus dem Einband ersichtlich. Der Obertitel scheint eine fachwissenschaftliche Epochendarstellung anzukündigen, während der Untertitel in das Genre der Belletristik verweist. In beiden Sparten erzeigt sich die Autorin Angela Steidele beeindruckend sattelfest: Sie hat die geistigen, lebensweltlichen und menschlichen Verhältnisse, von denen die sächsische Metropole Leipzig zwischen 1730 und 1760 geprägt war, in profunder Verlässlichkeit und staunenswerter Tiefenschärfe rekonstruiert, daneben aber auch eine hinreißende historische Phantasie entfaltet, deren wohlkalkulierter Zugriff nicht nur die Leerstellen der Überlieferung füllen, sondern zugleich mit dem Verbürgten ein listiges literarisches Spiel treiben will.
Als Ich-Erzählerin tritt Catharina Dorothea Bach, das älteste, aus erster Ehe stammende, unverheiratet gebliebene Kind des Thomaskantors und Komponisten Johann Sebastian Bach auf den Plan. Zu dieser der Einbildungskraft weiten Raum gewährenden Rolle mag sie der Umstand prädestiniert haben, dass man über sie von allen Bach-Kindern am allerwenigsten weiß. Munter spaziert sie mit der Leserschaft durch drei wichtige Leipziger Jahrzehnte, und dies keinesfalls in chronologischer Pedanterie, vielmehr in geistreich unterhaltsamem Wechsel der Zeitebenen. So lernt man das einstige barocke Weichbild der Messestadt kennen, bummelt aufmerksam durch Quandts Hof und vorbei am Romanus-Haus, ergeht sich in den prachtvollen Leipziger Gärten, besichtigt noch einmal das verlorengegangene Wohn- und Geschäftshaus »Große Feuerkugel« am Neumarkt oder den ebenfalls kriegsbedingt verschwundenen Barockbau des »Goldenen Bären«, der im Erdgeschoss der Verlegerfamilie Breitkopf Heim- und Werkstatt und in der Beletage den Gottscheds ein standesgemäßes Quartier bot.
Natürlich ist die hochmusikalische Bach-Sippe allgegenwärtig, der Thomaskantor findet sich in verblüffender Plausibilität als ein begnadeter, durch natürliche Autorität ausgezeichneter, energisch liebevoller Patriarch porträtiert, insonderheit freilich als der unvergleichliche kirchliche Musiker, der er war. Viele seiner Kantaten, Oratorien, Orgelwerke und Solistenstücke werden sprachlich glänzend eingespielt, und wenn die ihrerseits musikalisch fundiert gebildete Autorin auf die den zweiten Teil des »Weihnachtsoratoriums« eröffnende Sinfonie (77) oder die monumentale »h-Moll-Messe« (403–412) zugreift, dann werden diese Stücke geradezu unmittelbar hörfähig beschrieben. Selbst der verstörende Abbruch von Bachs unvollendeter »Kunst der Fuge« findet ein frappierendes sprachliches Abbild (430).
Besondere Nähe verbindet die Ich-Erzählerin mit ihrer Stiefmutter Anna Magdalena Bach. Sie versieht den Haushalt, geht ihr bei der Geburt und Aufzucht der kleineren Kinder zur Hand und teilt mit ihr die Sorgen um ihre größeren Geschwister, etwa den als eigenwillig verschlossen vorgeführten Wilhelm Friedemann Bach. Zudem animieren sich die beiden Frauen gegenseitig zur Pflege ihrer selbst Fürsten und Könige bezaubernden Singstimmen. Als Anna Magdalena im Februar 1760 stirbt, setzt sich Dorothea ans Klavichord und intoniert aus dem »Clavier-Büchlein« das berührende Stück »Schlummert ein, ihr matten Augen, fallet sanft und selig zu!« (534).
Die von Bach geschaffene und geleitete evangelische Kirchenmusik findet sich organisch in die aufklärerische Atmosphäre der Stadt und Zeit eingebettet. Intellektuelle Konflikte gehörten selbstverständlich dazu, doch Steidele ist klug genug, das abgehangene Fehlurteil, Bach sei ein Parteigänger des Pietismus gewesen, gar nicht mehr zu berühren. Allgegenwärtig in jenen Debatten ist natürlich auch der emsige Johann Christoph Gottsched, der sich als deutscher Poetik- und Literaturpapst geriert, in einer sich aus stattlicher Leibesgröße herablassender Freundlichkeit an der Leipziger Geselligkeit partizipiert und sich durch den gönnerhaften Umgang mit seiner stupend gebildeten Frau Luise zumindest in den Augen der Ich-Erzählerin peinlich blamiert. Überhaupt zählt die schmerzhaft intensive Freundschaft zwischen der »Jungfer Bachin« und der »Gottschedin« zu den am stärksten romanhaft und dabei moderat feministisch ausgeschmückten Partien des Buches, auch wenn es in der fiktionalen Dynamik wunderbar stimmig erscheint, dass die »Gottschedin« in heimlicher häuslicher Zusammenarbeit mit Bach das Libretto des »Weihnachtsoratoriums« verfasst habe, obschon sie tatsächlich erst etliche Monate nach der Uraufführung jenes Meisterwerks in die Stadt kommen sollte.
Es wird viel debattiert über die theologischen, philosophischen und literarischen, seltener auch die politischen Themen der Zeit. Man zankt sich über die Bedeutung von Leibniz, Newton, Rousseau und Voltaire, erörtert ausgiebig und kontrovers das manchen dringend reformbedürftig erscheinende Verhältnis der Geschlechter, findet auch im Schrecken über das Erdbeben von Lissabon kaum zueinander und repräsentiert gleichwohl in alledem eine idealtypische aufklärerische Sozietät. Allein Dorothea Bach zeigt sich irritiert: »Warum tun die Freunde des Lichts nichts lieber, als sich gegenseitig die Augen auszustechen? Haben Weltweise keinen besseren Feind als andere Weltweise?« (541 f.).
Als Leser freut man sich über die Begegnung mit etlichen Repräsentanten des eigenen Bücherschranks. Dabei gerät Christian Fürchtegott Gellert zu einer Karikatur seiner selbst: Die Erfolge seiner Fabeldichtungen und Poetik erscheinen unbegreiflich, er stapft hypochondrisch, tölpelhaft und selbstverliebt durch die Szenen, sein linkisches Gebahren erntet nur Häme und Spott: »Gellert kehrte Laub zusammen. Gegen den Wind.« (537) Die ungestüme Wucht des jungen Gotthold Ephraim Lessing, der mehrfach auftritt, mag den Eindruck erwecken: So etwa könnte es tatsächlich gewesen sein. Der noch deutlich jüngere Johann Wolfgang Goethe erfreut als eine unbekümmerte, geistreiche Frohnatur; dass er wegen seines hessischen Dialekts aufgezogen wird, kümmert ihn nicht, von der »Jungfer Bachin« lässt er sich in heiterer Aufmerksamkeit über den Unterschied zwischen Literaturwissenschaft und Dichtung belehren, und mit Johann August Ernesti erstellt er, schon jetzt polyhistorisch interessiert, »eine geographische Karte des Neuen Testaments« (567).
Der kritische Bibelexeget und Aufklärungstheologe Ernesti freilich erntet (zum Leidwesen des rezensierenden Theologiehistorikers) insgesamt wenig Sympathie: Als Rektor der Thomasschule wohnt er Tür an Tür mit den Bachs, von Kirchenmusik versteht und hält er kaum etwas, sein Charakter oszilliert zwischen Ehrgeiz und Pedanterie. Immerhin eilt er dem feministischen Emanzipationsstreben mit einer exegetischen Aufklärung über 1Kor 14,34 zu Hilfe: »Paulus kann den Satz, das Weib schweige, gar nicht gesagt haben. […] Es ergibt sich, dass der erste Brief des Paulus an die Korinther nicht aus einem Guss ist. Manche Teile sind älter, manche jünger, […] und zwar reden wir über Zeiträume viel länger als ein Menschenleben. Und der Satz mit den Weibern, die schweigen sollen, ist philologisch betrachtet ganz klar eine spätere Zutat.« (498 f.)
Und so möchte man fortfahren in der Schilderung des vielfältigen Personal-Tableaus. Indessen mag ein letzter Hinweis genügen: Grandios dargestellt ist auch der Besuch Johann Sebastian Bachs beim Preußenkönig Friedrich II. im Mai 1747 in Potsdam, wo ihm der naturnah porträtierte König – »Voilà, kommt mich der alte Bach auch einmal besuchen. Angenehme Voyage gehabt?« (347) – ein stümperhaftes Fugenthema vorgibt, aus dem dann das »Musikalische Opfer« hervorgehen sollte (vgl. 344–357). Später residiert Friedrich als Besatzer Leipzigs im dortigen Apelschen Haus, presst Stadt und Bürgerschaft erbarmungslos aus und gibt damit Anlass, auch die hautnah erlebten Schrecknisse und Grausamkeiten des Siebenjährigen Krieges dem Lesepublikum vor Augen zu führen.
Mehrfach hat sich Steidele das Vergnügen einer schalkhaften Vergegenwärtigung ihrer Historienerzählung erlaubt. So pflegen etliche der handelnden Personen einen Jargon, der den Zeitgenossen des frühen 21. Jahrhunderts entlehnt scheint. Auf dem Höhepunkt der militärischen Bedrängnis im Herbst 1759 lässt die Verfasserin regelmäßige Montags-Demonstrationen vor der Leipziger Nikolaikirche stattfinden. Selbst gelegentliche Kalauer goutiert man mit Schmunzeln: Als habe er erst kürzlich mit Donald Trump telefoniert, bekennt sich Friedrich II. pathetisch zu der Maxime: »Preußen zuerst!« (514). Und geradezu doppelbödig wird die Ironie, wenn Bach seinen Ruhm als Orgelvirtuose mit der Einschränkung versieht: »Vielleicht kommt einer, der reger als ich spielen wird« (355) – wobei es unter Musikfreunden kein Geheimnis darstellt, dass Max Reger manche seiner Orgelkompositionen gar nicht selbst zu intonieren vermochte.
Erheiternd sind auch die von der in Köln lebenden Angela Steidele mitunter eingestreuten ironischen Selbstbezüge. So lässt sie in der Leipziger Deutschen Gesellschaft darüber disputieren, ob es wohl statthaft sei, dass ein Kölner Autor namens Angelus Stadeler ein Buch über die Messestadt im 15. Jahrhundert verfasst. Ernesti protestiert: »Also, dieser Stadeler tut ja so, als ob er selber dabeigewesen wäre, vor dreihundert Jahren« (135). Die Debatte wogt hin und her, bis schließlich Gottsched das Urteil fällt: »Ein Dichter darf zwar nicht grob gegen die historische Überlieferung verstoßen, einige Freiheiten genießt er jedoch schon« (ebd.). Und am Ende, als die »Jungfer Bachin« ihr vollendetes Manuskript bei Breitkopf zum Druck bringen möchte, weist dies der Verleger mit den Worten zurück: »Das eigentliche Problem Ihres Textes ist, dass man nicht recht weiß, ist das nun Geschichtsschreibung oder Roman? Wie sollten wir Buchhändler Ihr Werk denn da anpreisen?« (588 f.). Wie gut, dass der Insel Verlag das von Steidele erstellte Typoskript besser zu schätzen – und zu verkaufen wusste!
Als Hybrid ist dieses Buch ein Glücksfall für beide Seiten, indem es gleichermaßen dem Historiker anschauliche fachliche Vergewisserung und dem Romanleser geistreiche heitere Unterhaltung zuteilwerden lässt. Auch Kirchenhistoriker schreiben ja, unbeschadet aller Quellentreue, letzten Endes Romane. Zu einem Glücksfall wie bei Steidele führt dies gleichwohl nur selten.
Albrecht Beutel (Münster/Westf.)