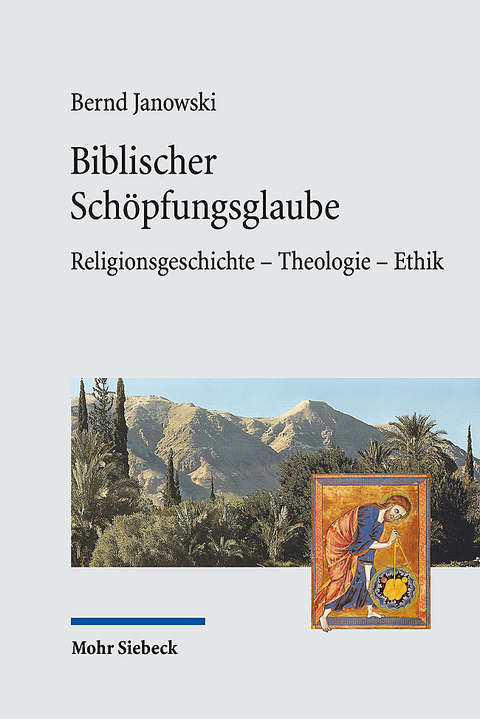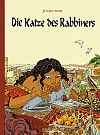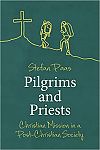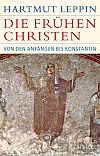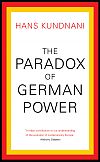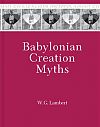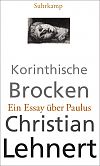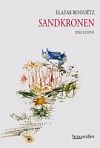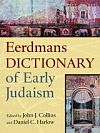Buch des Monats: Oktober 2017

Sommer, Andreas Urs
Werte. Warum man sie braucht, obwohl es sie nicht gibt.
Stuttgart: Metzlerverlag 2016. 152 S. Geb. EUR 19,95. ISBN 978-3-476-02649-1.
Aus dem gesellschaftlichen Diskurs unserer Zeit ist die Rede von Werten nicht wegzudenken. Die Bezugnahme auf Werte und die Appellation an Werte gehören zur Signatur moderner Industriegesellschaften. Evangelische Theologie stand der Rede von den Werten lange reserviert gegenüber. Wegweisend wurde hier im Kontext der Schwangerschaftsabbruchdebatte der Band von Carl Schmitt, Eberhard Jüngel und Sepp Schelz »Die Tyrannei der Werte«. Insbesondere der ontologische Status der Werte und ihre Bedeutung für den freien Diskurs wurden hier hinterfragt. Eine gewisse Reserve gegenüber der Wert-Terminologie ist im evangelischen Bereich bis heute zu spüren. Aber dem Diskurs über Werte und der Berufung auf Werte verschließt sich evangelische Theologie nicht, wenngleich nicht klar ist, was Werte eigentlich sind. Diese Frage stellt auch der Philosoph Andreas Urs Sommer in dem hier angezeigten Buch.
Ausgehend von der Beobachtung, dass Bewerten ein Grundvollzug menschlichen Lebens sei (23 ff.), geht er zunächst der Entstehung der Rede von den Werten in der Wertphilosophie nach und schließt sich der Kritik an einem ontologischen Verständnis der Werte an, wie sie schon Martin Heidegger vorbrachte und wie sie auch Herbert Schnädelbach in einer kritischen Rekonstruktion der Wertphilosophien zum Zuge bringt. Auch gegenüber der pragmatistischen These von Hans Joas, wonach Werte in Erfahrungen der Selbstbindung und der Selbsttranszendenz entstehen (dazu 77), verhält sich Sommer reserviert, weil man für das Verstehen der Werte hier eine ganze »Selbst-Metaphysik« (78) miteinkaufen müsse. Mit Joas teilt Sommer jedoch den konsequent historisierenden Zugriff auf die Werte. Als »ein ›Nachkömmling‹ des moralisch Guten« (39) sei der Wert-Begriff entwickelt worden, um auf das Wegbrechen der »weltanschaulichen und religiösen Rahmenbedingungen des in Alteuropa Gebotenen und Verbotenen« (40) zu reagieren. »Auf den lieben Gott konnte sich der Bürger nicht mehr verlassen. So bedurfte er wie die Philosophen einer neuen Selbstverständlichkeit – und merkte, dass doch alles, woran ihm lag, ‚Werte’ waren. Warum sollte das in der Moral anders sein als zu Hause, in Geschäft und Gesellschaft?« (41). Die Geschichte zeige dabei, »dass moralische Werte so formbar sind wie Wachs« (68), und dokumentiere darin, dass die Werte »etwas (vielleicht irreduzibel) Historisches sind« (31).
Im Nachwort erklärt Sommer, sein Buch sei aus einem Seminar über Werte und Wertphilosophien entstanden, in dem er ursprünglich die Absicht gehegt habe, dem »allgegenwärtige[n] Wertgerede« »ein Ende zu machen« (175). Doch beim »Füttern und Streicheln dieser Wundertiere« habe er »gelernt, dass sie trotz all der bombastischen Rhetorik, mit der sie im Zaum gehalten werden, erstaunlich zahm und ja sogar nützlich sind, wenn eine Gesellschaft wie die unsrige den Anspruch auf letzte Wahrheit preisgegeben hat« (175). Diesen Wandel in Sommers Bewertung der Werte merkt man dem Buch noch an, fallen die ersten Kapitel im Ton doch deutlich kritischer aus als die späteren, in denen er die Bedeutung der Werte herausarbeitet. Das geschieht in teils kritischer Absetzung von bestimmten Wertetheorien, vor allem aber der historiographischen Inszenierung, die Sommer in H. A. Winklers Geschichte des Westens findet (vgl. 118–121).
In konstantem Dialog mit dem »gestandenen Wertontologen«, der das ganze Buch durchzieht, eruiert Sommer Existenz, Zahl, Art, Bezug, Position und Funktion der Werte. Werte seien Fiktionen, aber gerade als solche existierten sie. Der moderne Wertbegriff lebe »als Zwitterwesen aus Moral und Ökonomie« (39) von der damit verbundenen doppelten »Erbsubstanz« und entfalte seine besondere Stärke und Anschlussfähigkeit durch die Suggestion von »Bezifferbarkeit«, »Vielfalt« (31) und »Weltstrukturierungskraft« (32). Wenngleich die Werte menschliche Fiktionen seien, bezögen sie ihre Orientierungskraft in moralischen Kommunikationszusammenhängen daraus, dass sie eben »nicht als etwas Entstandenes, Bedingtes, damit Gemachtes erscheinen« (54), sondern »als bereits für sich bestehend ausgegeben werden« (54). Werte sind für Sommer insofern regulative Fiktionen (142). Kennzeichnend sei für sie im Unterschied zum Begriff des absoluten Guten ihre Vielfalt und ihre wachsende Zahl, mit der sie auf die Vervielfältigung der moralischen Bedürfnisse in der zunehmenden Vielgestaltigkeit modernen Lebens reagierten. Dies führe zu einer »Werteinflation« (55), die Sommer nicht beklagt, sondern als Indiz für die Freiheit einer Gesellschaft bejaht (vgl. 61). Demgegenüber sei »Wertedeflation, das Zusammenschnurren eines bunten und breiten Werterepertoires auf wenige Werte, womöglich auf ein einziges, unverbrüchliches und keinen Widerspruch duldendes Gutes, der normale Weg, den moderne Gesellschaften auf dem Weg in den Totalitarismus einschlagen: Die Wertevielfalt wird kontinuierlich abgebaut, bis es plötzlich nur noch einen einzigen Wert gibt – etwa den der eigenen Rasse« (59). Die Entstehung der Werte zeuge nicht von einem allgemeinen Niedergang und moralischer Verwahrlosung, sondern vielmehr vom »Rückgang moralischer Indifferenz« (88). Als Beispiele führt er den Wandel in der Einstellung zur Kinderarbeit und zur Bestrafung homosexueller Handlungen an.
Der Vorteil der Werte im Unterschied zu starren Prinzipien liegt nach Sommer »in ihrer Dynamik, ihrer Variabilität, ihrer Dehnbarkeit, ihrer Leidensfähigkeit« (151). In ihrer Vielfalt verflüssigten und dynamisierten die Werte herkömmliche Entweder-Oder-Unterscheidungen in den Binärcodes von gut/böse und Sein/Nichtsein (vgl. 84) und stellten stattdessen Beziehungen und Bindungen her (vgl. 83). »Sie verbinden Unverbundenes miteinander. Sie leisten – als regulative Fiktionen – die Verbindung von Sphären, die bis dahin nichts miteinander zu schaffen zu haben schienen. Der Wert der Freiheit beispielsweise verzahnt Politik mit Ökonomie, Selbstbestimmung mit Gruppeninteresse.« (141) Dies gelinge gerade, weil Werte selbst relativ seien und sich nicht mit einem universalen Absolutheitsanspruch positionierten, sondern in »der instabilen Seitenlage« (122). Gerade so erwiesen sich die Werte als Kinder der Moderne.
Sommers Buch ist provozierend, nicht zuletzt durch viele alltagssprachliche Metaphern, mit denen er wertontologisches Denken aufspießt und der Inanspruchnahme von Werten in gesellschaftlichen Diskursen den Spiegel vorhält. Aber so sehr Sommer seinem gestandenen Wertontologen die Ontologie bestreitet und betont, dass Philosophie keine Wertwissenschaft sein solle (174), so sehr deckt er doch – eigentlich ganz im Interesse des Wertontologen – die Bedeutung der Rede von Werten für die moralische Orientierung in unserer Gesellschaft auf und macht deutlich, was fehlen würde, »wenn keine Werte wären« (174). Wer dem Sinn der Rede von Werten nachgehen will, findet in diesem Buch eine außerordentlich stimulierende und hilfreiche Analyse.
Friederike Nüssel (Heidelberg)