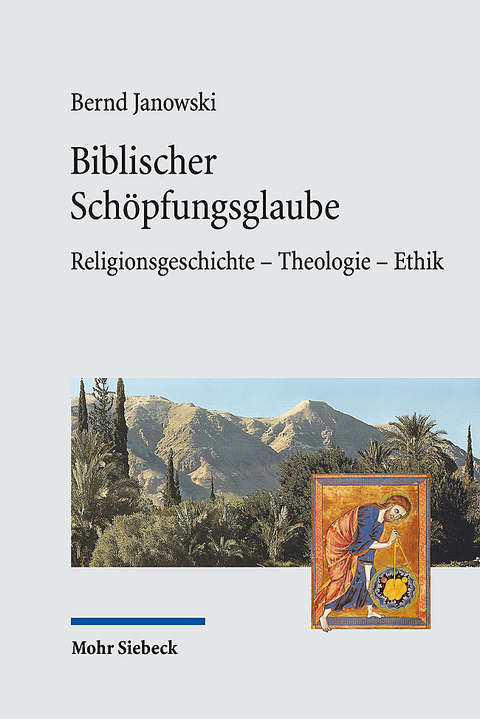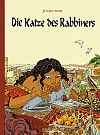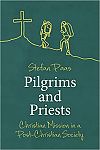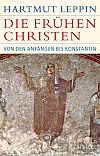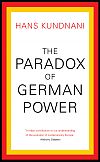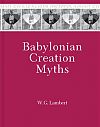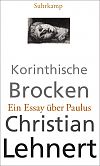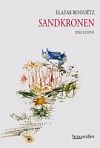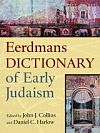Buch des Monats: März 2015

Macha, Jürgen
Der konfessionelle Faktor in der deutschen Sprachgeschichte der Frühen Neuzeit
Würzburg: Ergon Verlag 2014. 239 S. m. 28 Abb. = Religion und Politik, 6. Lw. EUR 39,00. ISBN 978-3-95650-010-7
Der Münsteraner Sprachhistoriker Jürgen Macha, Schüler des bedeutenden Germanisten Werner Besch, ist schon durch seine Herkunft aus einer konfessionellen „Mischehe“ (15) und erst recht durch seine projektbezogene Einbindung in das Exzellenzcluster „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne“ zu der vorliegenden Studie angeregt worden. In Aufnahme einschlägiger Forschungsergebnisse und bei kräftiger Zuspeisung eigener ausgreifender Untersuchungen entstand damit ein multidisziplinär valentes Basiswerk zu dem soziokulturellen Phänomen der „sprachlichen Konfessionalismen“ (22 u. ö.) in der Frühen Neuzeit. Als Motto ist dem Buch sinnigerweise der in Mt 26,73 verzeichnete Bibelvers „Wahrlich, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich“ vorangestellt. Tatsächlich wurde der seit dem 16. Jahrhundert im deutschen Sprachraum zu beobachtende Prozess sprachgeschichtlicher Uniformierung durch konfessionsspezifische Sprachgewohnheiten massiv retardiert und teilweise sogar konterkariert. Ein raffiniertes kontroverstheologisches „Vexiergedicht“ aus nachreformatorischer Zeit (27 f.) vermag das Interesse an der Sachproblematik auf höchst vergnügliche Weise zu schüren.
Das auf die „Einleitung“ folgende zweite Kapitel firmiert unter der bescheidenen Überschrift „Untersuchungsrelevante Vorüberlegungen“, bietet aber gleichwohl dichte, sachhaltige Informationen zu den frühneuzeitlichen Konfessiolekten und zu der namentlich im Vergleich von Kanzlei- und Büchersprache hervortretenden „Heterogenität des frühneuzeitlichen Deutsch“ (38), die seit dem 16. Jahrhundert unvermindert anhielt und erst durch das „zweckrationale Denken der Aufklärung“ (44), also im Verlauf des 18. Jahrhunderts in eine „relative Homogenität der Schriftlichkeit“ (47) überführt werden konnte.
Das dritte Kapitel bietet sodann anschauliche Konkretionen, indem es „Befunde zu einzelnen Regionen“ vorstellt und kontextuell interpretiert. Am Beispiel der bereits früh zum Luthertum übergetretenen Reichsstadt Nürnberg zeigt Macha ebenso eindrücklich wie detailliert, dass und inwiefern diese Kommune dabei „nicht nur ihren Glauben, sondern auch ihre Sprache“ (51) reformiert hat. Nicht weniger instruktiv sind die konfessionssprachlichen Erhebungen für das alsbald rekatholisierte Österreich oder die von der Gegenreformation geprägten Regionen im deutschen Nordwesten. Einen Musterfall sprachhistorischer Konfessionsforschung bietet zumal Donauwörth, weil diese protestantisch geprägte Freie Reichsstadt im Jahre 1607 durch das katholische Bayern gewaltsam annektiert wurde. In Auswertung zahlreicher gattungsspezifischer Analysen vermag Macha zu zeigen, dass in Donauwörth zwar die Basisvarietät „süddeutsche Reichssprache“ erhalten blieb, dabei aber gleichwohl eine deutliche graduelle Transformation der konfessionsbedingten Sprachmerkmale (vgl. die Tabelle S. 87!) zu beobachten ist, deren Eigenart sich mit der von Paul Rössler geprägten Formel „cuius re(li)gio, eius scriptio“ (88) bilanzieren lässt.
Gleichermaßen aufschlussreich sind die daraufhin fixierten „Befunde zu einzelnen Textsorten“ (Kap. 4). So lassen sich etwa für die Glockeninschriften deutliche konfessionstypische Textmuster nachweisen. Noch signifikanter treten die Konfessionsdifferenzen in der nachreformatorischen Epigraphik und namentlich bei Grabinschriften hervor: Die Vokabeln „nicht“ (lutherisch) bzw. „nit“ (katholisch) erhalten religionsparteilichen Signalcharakter; Bibeltexte begegnen in katholischen Funeraltexten fast nie, auf evangelischen Gedenksteinen dagegen sehr häufig, wobei allerdings die Textgestalt der Lutherbibel offenbar recht freizügig einer „sprachlandschaftlichen Anpassung“ (118) unterzogen wurde.
Eine Sammlung von „Einzelbefunde[n]“ erweist weitere „sprachliche Konfessionalismen als signa distinctiva“ (Kap. 5). Dem unscheinbaren „lutherischen -e“ kommt dabei eine erhebliche kontroverstheologische Bedeutung zu (128–135). Dieser unbetonte, im Auslaut verschiedener Wortformen auftretende Vokal markierte unübersehbar, übrigens bis ins 18. Jahrhundert, die Glaubensrichtung des Schreibers, indem er zwischen evangelischer „Hölle“ und katholischer „Höll“, zwischen reformatorischer „Sünde“ oder „Seele“ und altgläubiger „Sünd“ oder „Seel“ einen unüberbrückbaren Graben zog, sich aber auch in so religionsneutralen Formen wie „Bub(e)“ oder „ich red(e)“ noch niederschlug. Als eine entsprechende konfessionsparteiliche Duftmarke erwies sich auch der Gebrauch der Großschreibung: Während die zu Beginn des 16. Jahrhunderts allgemein übliche Gepflogenheit, lediglich am Satz- oder Versanfang sowie bei Eigen- und Gottesnamen Versalien zu verwenden, auf evangelischer Seite alsbald in die modernitätsträchtige Großschreibung aller Substantive überging, hielt die auf Differenzbetonung abhebende katholische Schreibweise noch lange an der graphematischen Besonderheit des Frühneuhochdeutschen fest (vgl. 139–141). Von konfessionsspezifischer Relevanz war zudem die Entscheidung, ob es zur katholischen „Kommunion“, zum lutherischen „Abendmahl“ oder zum reformierten „Nachtmahl“ ging, ob das „Vater unser“ (katholisch) oder „Unser Vater“ (evangelisch) gebetet wurde, ob von „Job“, „Moses“ und „Noe“ (katholisch) oder von „Hiob“, „Mose“ und „Noah“ (evangelisch) die Rede war und ob die Kinder bevorzugt nach biblischen, meist alttestamentlichen Figuren (evangelisch) oder lieber nach dem Heiligenkalender (katholisch) benannt wurden.
Dass dieses Standardwerk gar nicht erst den Versuch unternimmt, sich in die seit Jahrzehnten anhaltende, zusehends ermüdende Konfessionalisierungsdebatte einzumischen, steigert nur seinen Wert. Dagegen wäre es nachhaltig zu begrüßen, wenn sich die professionellen Konfessionalisierungstheoretiker dazu verstehen wollten, ihre geistreich-abstrakten Überlegungen durch Bezugnahme auf die hier handgreiflich präsentierten und sachkundig interpretierten Phänomene gleichsam zu erden und realhistorisch zu verifizieren.
Jürgen Macha verstarb, kaum 64-jährig, im Januar 2014. Dadurch sind seine Absicht, für weitere Untersuchungen, an denen sich auch Frühneuzeit- und Theologiehistoriker beteiligen sollten, wegweisende Anregungen und Impulse zu liefern (25), und die dezidierte Vorläufigkeit seines „Resümee[s] in neun Punkten“ (207–212) zu einem Vermächtnis geworden.
Albrecht Beutel