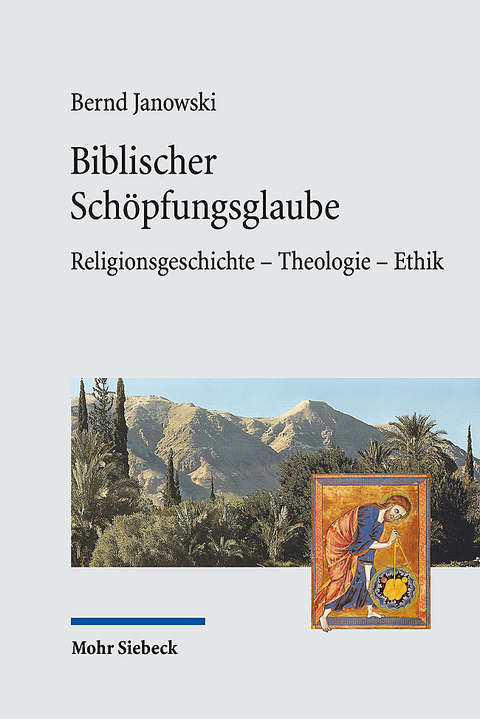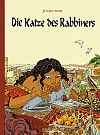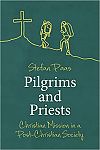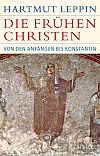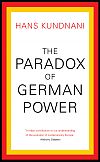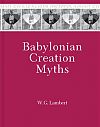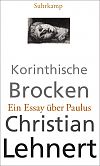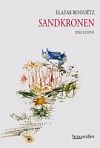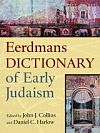Buch des Monats: September 2022
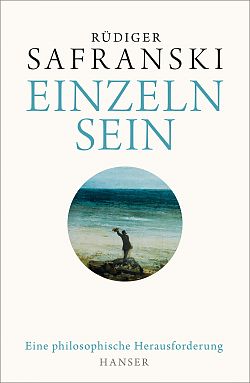
Safranski, Rüdiger
Einzeln sein. Eine philosophische Herausforderung.
Hanser Verlag 2021. 288 S. Geb. EUR 26,00. ISBN 9783446256712.
An den Begriff der «Individualisierung» haben wir uns gewöhnt. Seit den 1960er Jahren ist er samt der kollateralen Phänomene ein treuer Begleiter soziologischer und sozialphilosophischer Diskurse. Individualisierung ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Aber versteht sich von selbst, was in aller Munde ist? Was bedeutet es für jeden von uns, dass das Individuum als unteilbar letztes Glied der Gemeinschaft ein Einzelner und als solches Projekt seiner selbst geworden ist? Ist es nicht so? »Einzeln sein: Da denkt man sogleich an Selbstverwirklichung […]. Einzeln sein bedeutet, aus einer Tatsache – jeder ist einzeln – eine Aufgabe zu machen, für das Leben und das Denken.« (9)
Mit dieser lapidar formulierten und doch so folgenreichen Einsicht beginnt Rüdiger Safranski sein feines und kluges Buch. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Aufgabe, ein Individuum zu sein, nachzudenken. Was im Untertitel eine philosophische Herausforderung genannt wird, ist tatsächlich eine Lebensaufgabe. Dass das Philosophieren über die Lebensaufgaben ein Kerngeschäft der Philosophie ist, weil das Leben den eigentlichen Stoff zum Nachdenken gibt, entfaltet der Philosoph, Germanist, Historiker, Autor und begnadete Erwachsenenbildner in sechzehn Kapiteln, die sich jeweils einem einzelnen Denker widmen. Ihr gemeinsamer Stoff ist die Erfahrung einer zunehmend bewusst wahrgenommenen und sich verstärkenden Vereinzelung – die verbindende Geschichte, die nicht als Geschichte erzählt wird, aber sich aus der chronologischen Abfolge der Kapitel nahelegt, nimmt ihren Ausgang in der Renaissance und mündet in die existenzphilosophischen Entwürfe der Kriegs- und Nachkriegsjahre, die auf die großen kollektiven Katastrophen des 20. Jahrhunderts antworteten. Was in Wellen kommt und geht, um sich von Neuem zu wiederholen, ist ein Thema, das einzelne Denker schon lange beschäftigt hat, aber mehr und mehr ins Bewusstsein der Massen gedrungen ist. Wir sind singulär. Ist das nicht ein Widerspruch? Man könnte es auch so sagen: Mit unserer Vereinzelung werden ›wir‹ als Verbund der je Einzelnen weder im Leben noch im Denken ein für alle Mal fertig. Wer Individualisierung im qualifizierten Sinne einer Lebensaufgabe der Selbstwerdung begreift, findet reichlich Stoff für die Schlussfolgerung, dass sie kollektiv, d. h. als soziale, gesellschaftliche und kulturelle Aufgabe auf jeden Fall eine unmögliche Möglichkeit vorstellt. Deshalb macht es Sinn, was Safranski seinem Versuch, die Dinge auf die Reihe zu bringen, im vorsichtigen Konjunktiv voranstellt: »Es wird hier auch keine umfassende Theorie über das Einzeln-Sein versucht. Das wäre wohl auch paradox, denn wenn man den Einzelnen wirklich ernst nimmt, dann gibt es eben nur Einzelfälle, die jeweils zu denken geben.« (10)
Es ist darum auch konsequent, wenn Individualisierung als Denk- und Lebensaufgabe anhand von Menschen gezeigt wird, die qua ihrer philosophischen oder theologischen Existenz das Einzeln-Sein vordenken und vorleben. Wie ein roter Faden zieht sich diese Erkenntnis durch die sechzehn Miniaturen. Ob Martin Luther oder Jean-Jacques Rousseau, Ricarda Huch oder Hannah Arendt – es ist von Männern und Frauen die Rede, die das Einzeln-Sein bezeugen, durchdenken und manchmal auch durchleiden. Sie sind besonders, weil sie den Mut haben, anders zu sein als die Menge. Vielleicht ist Søren Kierkegaard der exemplarische Fall eines Vorreiters der Singularität, der vom Pferd gefallen ist, der weiß, dass er fallen muss und dennoch weiterreitet? Sein Tagebucheintrag vom Dezember 1847 liest sich wie ein vorweggenommenes Vermächtnis und geheime Mitte von Rüdiger Safranskis Erkundungsgang: »Mit der Kategorie ›der Einzelne‹ nahm ich seinerzeit, als alles hierzulande System und aber System war, das System zum Angriffsziel […]. Mit dieser Kategorie ist meine mögliche geschichtliche Bedeutung unbedingt verknüpft.« Genauso ist es gekommen.
Dass Rüdiger Safranski Kierkegaards sperrigeren Begriff des Einzelnen und nicht den glatteren Begriff des Individuums aufgegriffen hat, ist kein Zufall. Er geht nicht darauf ein und macht überhaupt kein großes Aufheben darüber, wie er beispielsweise darauf gekommen ist, ausgerechnet diese sechzehn Menschen zu Wort kommen zu lassen. Der Autor Safranski hat einen bescheidenen Auftritt. Mehr noch: Er tritt vornehm zurück und lässt seinen Gästen viel Raum, von sich zu erzählen und über sich selbst zu reflektieren. Die ganz und gar uneitle, unaufgeregte, auf die Sache konzentrierte und wohltuend verständlich geschriebene Studie macht dabei eine schöne Pointe. Rüdiger Safranski beweist, dass ein Autor, der ganz bei sich selbst ist, sich nicht nonstop selbst behaupten muss. Was ihn als Autor umso lesenswerter macht! Eine herausragende Qualität des Buches ist sein Charme des einfachen Stils. Er zeigt sich daran, dass einer, der weiß, wovon er redet, auch die Kunst versteht, seinen Leserinnen und Lesern die Philosophie des Singulären nahezubringen und das Philosophieren lieb zu machen. Der Autor versteckt sich auch nicht. In feinsinnigen Zwischenbetrachtungen werden die vereinzelt losen Denkfäden zu kleinen Netzwerken verknüpft, mit denen die Gedankenschmetterlinge eingefangen werden. Das Vereinzelte macht erst in der Versammlung Sinn. Denn das versteht sich fast von allein! Es gibt keine Singularität ohne Bezug auf Sozialität. Das Einsam-Sein hat das Gemeinsam-Sein nicht nur zum Angriffsziel. Es ist auch sein Ausgangsort.
Die pfiffigen Einsichten ins Denken der Einsamen über ihr Alleinsein eignen sich hervorragend für eine Lektüre im Kontext der Erwachsenenbildung. Sie beschert auch den philosophisch arrivierten Leserinnen und Lesern manche Anstöße und wertvolle Impulse zum Weiterdenken. Besonders gut gefiel dem Rezensenten das Kapitel über Hannah Arendt und das »Zwei-in-einem«, weil der Autor so schön herausarbeitet, warum sich Hannah Arendt und Martin Heidegger in manchen Dingen zwar einig, aber eigentlich nicht eins waren. Warum Hannah Arendts »Natalität« und Schwung zum Anfang definitiv der sympathischere Schluss, den man aus dem Bewusstsein seiner Existenz ziehen kann, als Martin Heideggers Hang zum «Sein zum Tod», muss hier nicht im Einzelnen geklärt werden.
Ralph Kunz (Zürich)