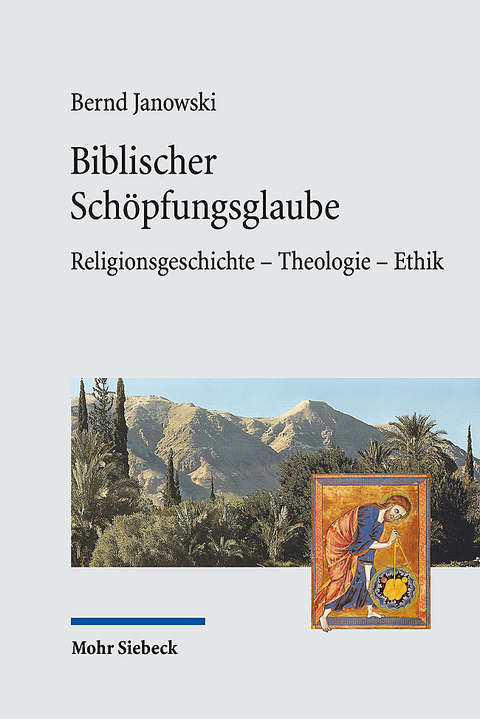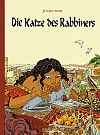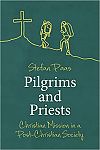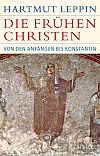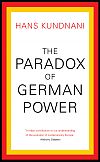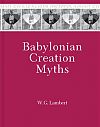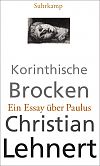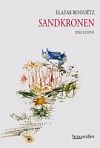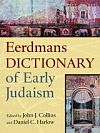Buch des Monats: Dezember 2015
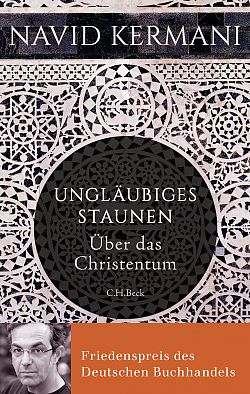
Kermani, Navid
Ungläubiges Staunen. Über das Christentum. 2. Aufl.
München: C. H. Beck Verlag 2015. 303 S. m. 49 Abb. Geb. EUR 24,95. ISBN 978-3-406-68337-4.
Seit über 100 Jahren gibt es – als Stiftung des jüdischen Berliner Industriellen Eduard Arnhold – in Rom die „Deutsche Akademie Rom – Villa Massimo“, ein bezauberndes Idyll an der Via Nomentana. Hier dürfen rund zehn auf dem Gebiet der bildenden Kunst, Literatur, Komposition und Architektur tätige Stipendiatinnen und Stipendiaten für ein Jahr leben und arbeiten: Die allermeisten der Geförderten setzen sich natürlich während dieses Jahres, aber auch danach, mit der Stadt, in der sie leben, auseinander. Insofern ist es nicht verwunderlich, wenn ein ehemaliger Stipendiat der Villa Massimo ein Buch vorlegt, aus dem deutlich wird, wie sehr ihn die stadtrömische Kunst beeindruckt hat, insbesondere die so unterschiedlichen Zeitgenossen Guido Reni und Caravaggio. Die Neue Züricher Zeitung hatte den Autor gebeten, acht „Bildansichten“ aus Rom zu schreiben und acht Jahre nach seinem römischen Jahr liegt nun ein Buch mit rund vierzig Bildbetrachtungen vor. Es sind Texte zu Bildern von Caravaggio dazugekommen, die in den großen Museen der Welt hängen, aber auch Stücke zu mittelalterlicher Kunst, zu El Greco, Rembrandt und Veronese. Zwei zeitgenössische Künstler haben ebenfalls Aufnahme gefunden: Gerhard Richter mit seinem bekannten Querhausfenster im Kölner Dom und Karl Schlamminger mit einem Kreuz. Der Beck-Verlag hat aus all dem ein wunderschönes Buch gemacht, qualitätvoll illustriert, mit Vergnügen anzuschauen und zu lesen. In der nächsten Auflage sollten allerdings auch die Bilder aufgenommen werden, die nicht im Zentrum eines jeweiligen Kapitels stehen – mir jedenfalls sind nicht alle Bilder in einzelnen Räumen des Prado vor Augen (161).
So besehen, handelt es sich bei dem Buch um nichts Besonderes, entsprechende Veröffentlichungen mit Bildbetrachtungen zu stadtrömischer und sonstiger christlicher Kunst aus der Feder von Laien wie Fachleuten gibt es wie Sand am Meer. Nun stammt das hier anzuzeigende Buch allerdings aus der Feder eines deutschen Schriftstellers, „der selbst ein Muslim ist“, wie es auf dem Klappentext heißt – der in Köln lebende Schriftsteller, Publizist und Islamwissenschaftler Navid Kermani hat es verfasst. Schon diese schlichte Tatsache macht das Buch einzigartig unter den vielen mehr oder weniger erbaulichen Betrachtungen christlicher Kunst. Die Besonderheit solcher Deutung christlicher Kunst aus muslimischer Feder ist schon früher aufgefallen und hat öffentliche Debatten ausgelöst: Eine der Bildbetrachtungen Kermanis für die Neue Züricher Zeitung, ein Stück über eine Kreuzigung von Guido Reni aus den Jahren 1635-1638 im Hauptaltar der Kirche San Lorenzo in Lucina, stand vor sechs Jahren im Mittelpunkt einer heftigen Kontroverse um den Hessischen Kulturpreis. Die Sätze, die damals so große Debatten auslösten, finden sich allerdings nun nicht mehr in der Betrachtung – und schon diese schlichte Tatsache macht deutlich, dass der Autor sich seit dem Jahr 2008 noch stärker an das Christentum angenähert hat, obwohl er sich weiter als „Ungläubiger“ charakterisiert. Von „Gotteslästerung und Idolatrie“ ist im Blick auf die Kreuzigung von Reni nicht mehr die Rede, vielmehr endet das deutlich verlängerte Stück im Buch (63-73) mit Bemerkungen zur lateinischen Messe und einem Versuch, Hölderlins Hymne „Patmos“ zu dem Gesehenen und Erlebten in Beziehung zu setzen. Aus einem durchaus ambivalenten Stück in der Tageszeitung ist im Buch eine regelrechte Meditation über die Gegenwart des lebendigen Christus in der lateinischen Messe geworden, durchaus weiter mit skeptischen Zügen. Allerdings findet sich die Kritik an der Verehrung des Kreuzes und der christlichen Kreuzestheologie als barbarische, körperfeindliche Hypostasierung des Schmerzes (samt dem Satz „ich könnte an ein Kreuz glauben“) nun an anderer Stelle des Buches wieder, in einem Abschnitt zu einer von aller Körperlichkeit abstrahierten Kreuzesdarstellung von Karl Schlamminger (50). Schlamminger ist in seinen Arbeiten deutlich von bestimmten Formen der Kunst im Islam, beispielsweise der Kalligrafie, beeinflusst. Trotzdem fällt es immer noch schwer, Kermanis Dialektik von Ablehnung des Kreuzes und Faszination durch das Kreuz zu folgen, auch wenn sie nun nicht mehr anhand des Bildes von Guido Reni, sondern anhand einer Skulptur von Karl Schlamminger entfaltet wird. Denn selbst wenn Inkarnation für Kermani ein Prinzip ist und sich nicht „in nur einem Menschen“ realisiert haben sollte (so 51), werden doch so menschliche Brutalität und Schmerz in dieser Welt erst recht und geradezu in Gestalt einer Theologie der Schmerzen Gottes hypostasiert. Aber ist das die richtige Frage an den Text eines Schriftstellers? Schließlich heißt es in der ersten, von Kermani nicht zitierten Zeile der Hymne des einstigen Tübinger Theologiestudenten Hölderlin: „Nah ist/ Und schwer zu fassen der Gott“.
Das Christentum, dem sich Kermani mit ungläubigem Staunen, aber auch beeindruckt, ja „bezwungen“ von seiner Kraft nähert, ist – vermittelt durch katholische Freunde, die im Buch zu der Gestalt eines katholischen Freundes verschmelzen – jenes stark ästhetisch orientierte, stark protestantismuskritische nachkonziliare Christentum, das im intellektuellen Umfeld von Benedikt XVI. insbesondere in Rom gewaltig an Einfluss gewann; nicht zufällig hat Martin Mosebach unlängst seine Hochachtung vor dem ungläubigen Staunen seines Freundes Kermani öffentlich bekundet. Die eucharistische Frömmigkeit, für die im Buch eine prachtvolle gotische Monstranz aus dem Kölner Diözesanmuseum steht, erzeugt bei Kermani „jenes ungläubige Staunen, das Caravaggio dem Thomas ins Gesicht schrieb“ (212). Gemeint ist das Staunen im berühmten Bild, das heute in der Bildergalerie Friedrich des Großen in Potsdam-Sanssouci aufbewahrt wird. Kermani verwendet das Wort „Sog“, um zu beschreiben, wie die Seitenwunde den greisen Thomas förmlich in den Körper Christi hineinzieht und er ungläubig mit seinen Augen und dem ganzen Kopf seinem ausgestreckten Zeigefinger folgt, den Christus in seine Wunde hereinzieht (218 f.). Caravaggios Bild malt denjenigen „Sog“, den der eucharistische Gottesdienst auch bei Kermani offenbar bisweilen erzeugt, „obwohl ich es nicht glauben kann“ (212). Man tut dem Autor sicher kein Unrecht, wenn man das als fast schon katholische Frömmigkeit bezeichnet, die neben Rom tief vom „Heiligen Köln“ geprägt ist. Selbst für die Heiligenverehrung ist Kermani mindestens offen: Petrus „war kein gewöhnlicher Mann“ (126). Protestanten sind für den Autor dagegen den Blinden vergleichbare, aller Sinnlichkeit abholde Christenmenschen, die die religiösen Zeichen nicht zu deuten vermögen: Um die erotischen Untertöne der Darstellung der Maria in einem Bild von Perugino zu übersehen, muss man „entweder blind oder ein Protestant sein“ (144). Kermani klagt über die „Formlosigkeit heutiger Gottesdienste“ (259) wie Mosebach und andere dieser Richtung auch, dazu über Kirchentage und Evangelische Akademien, aber er bemüht sich immerhin um Gerechtigkeit für den Siegener Pietismus, der sein Bild vom Protestantismus geformt hat, wie übrigens auch für den im vergangenen Jahr gestorbenen Bielefelder Historikers Hans-Ulrich Wehler. Angesichts des allgegenwärtigen Hedonismus, „dem Heiligsten der kapitalistischen Propaganda“, und der „alltäglich gewordenen Pornografie“ schwindet ihm dann sogar der Widerwillen gegen die Askese und Prüderie der einstigen Siegener erwecklichen Mitschülerinnen und Mitschüler.
Und doch wäre es zu kurz gegriffen, die Bildbetrachtungen von Kermani als Seitenstück des stark ästhetisch wertenden, konservativen Katholizismus eines Martin Mosebach und anderer zu rubrizieren und – gar noch beleidigt über das allzu schlichte Protestantimusbild – beiseitezulegen. Schließlich sind es nur mittelbar das barocke Heilsdrama und die lateinische Messe, die Kermani am Christentum beeindrucken. Das schreibt er selbst ganz deutlich: „Wenn ich etwas am Christentum bewundere, oder vielleicht sollte ich sagen: an den Christen, deren Glaube mich mehr als nur überzeugte, nämlich bezwang, aller Einwände beraubte … dann ist es nicht etwa die geliebte Kunst, nicht die Zivilisation mitsamt der Musik und Architektur, nicht dieser oder jener Ritus, so reich er auch sein mag. Es ist die spezifisch christliche Liebe, insofern sie sich nicht nur auf den Nächsten bezieht.“ (169) Solche Sätze erklären, warum sich neben den fast vierzig Bildbetrachtungen auch zwei Stücke über Christen im Buch finden, die Kermani tief beeindruckt haben – in der Buchmitte ein Kapitel über den italienischen Jesuiten und Islamwissenschaftler Paolo dall’Oglio, der seit 2013 im syrischen Raqqa spurlos verschwand, und, wenn er noch lebt, wahrscheinlich als Geisel vom „Islamischen Staat“ festgehalten wird, und zu Beginn des letzten Drittels ein Stück über das serbisch-orthodoxe Kloster Dečani im Westen des Kosovo, einem im Kosovo-Krieg wie danach vielfach zwischen Albanern und Serben umkämpften Ort, an dem der 1331 verstorbene serbische König Stefan Uroš III. Dečanski begraben liegt und sich berühmte mittelalterliche Fresken finden. So, wie sich Pater dall’Oglio in Syrien als römisch-katholischer Christenmensch auf den Islam der Menschen in der Nachbarschaft einlässt und sich selbst als Muslim betrachten kann (186), so vertieft sich Kermani in das Christentum, selbst wenn sein Bild von Christentum viel stärker durch die christliche Kunst und den nachkonziliaren konservativen Katholizismus geprägt ist als das Islambild jenes Jesuiten, der sein Leben für die das friedliche Miteinander der Religionen einsetzt. Kermani schreibt: „Aber die Liebe, die ich bei vielen Christen und am häufigsten bei jenen wahrnehme, die ihr Leben Jesus verschrieben haben, den Mönchen und Nonnen, geht über das Maß hinaus, auf das ein Mensch auch ohne Gott kommen könnte: Ihre Liebe macht keinen Unterschied.“ (169) Im Endergebnis führt diese Vertiefung in das Christentum zu einer ganz eigenen Deutung der Überlieferung, beispielsweise der Erzählung von der Opferung Isaaks. Kermani begründet seine ganz selbstständige Deutung so: „Es ist mein eigenes Christentum, wie ich davor schon zu meinem eigenen Islam gekommen bin. Ich gründe es auf den Sohn, weil er mich anschaut.“ (203). In solcher mystischen Frömmigkeit schwinden die scharfen Grenzen, die die Religionen trennen. Zu solchen ganz eigenen Deutungen kommt es, weil sich Kermani regelrecht in die biblischen Geschichten, die auf den von ihm ausgewählten Bildern dargestellt sind, versenkt und Fragen stellt, die zu stellen wir uns längst abgewöhnt haben: Es ist eigentlich schwierig für Lazarus aufzuerstehen? Wie geht es Petrus, wenn er gekreuzigt wird? Möchte Jesus überhaupt ins Nichts gehen?
Angesichts eines so bewegenden persönlichen Zeugnisses eines vom Christentum offenkundig tief beeindruckten Nichtchristen, der sich außerordentlich tief auf die ihm eigentlich fremde Religion einlässt, sollten fachwissenschaftliche Einwände zurücktreten, zumal sich Kermani mit entsprechenden salvatorischen Klauseln bei der Interpretation seiner Bilder absichert, „um keinen Rüffel der Fachwelt zu riskieren“ (139).
Trotzdem fragt man sich, was eigentlich der im Nachwort erwähnte Kirchenhistoriker bei seiner Durchsicht getan hat, wenn die höchst stilisierte Autobiografie des Hieronymus so nacherzählt wird, als habe Stefan Rebenich niemals auf die konstruktiven Elemente dieser Biographie aufmerksam gemacht (129) oder Armin von Gerkan niemals die Ausgrabungsbefunde unter dem Papstaltar von St. Peter im Vatikan mit spitzer Feder auseinandergenommen (216 f.). Ganz sicher ist das österliche „Lichtwunder“ in der Grabeskirche nicht die „älteste, unverändert praktizierte Zeremonie der Christenheit“ (243); die ersten literarischen Zeugnisse dieses Brauches stammen aus dem neunten Jahrhundert und es gehört schon eine gehörige Portion Vertrauen in die Kontinuität der Überlieferung dazu, die angebliche Selbstentzündung des Osterfeuers ohne menschliches Zutun in die Zeit vor der Errichtung der konstantinischen Grabeskirche zurück zu projizieren. Irgendwie gelingt es der Wissenschaft auch trotz aller Mühen nicht, den Erzhäretiker Arius vor der interessierten Öffentlichkeit in ein besseres Licht zu rücken; es bleibt allzu oft bei jenem Schlagschatten, der auf die Zerrbilder des großen Athanasius zurückgeht. Auch nach Kermani leugnete Arius die Trinität (88; was er ganz sicher nicht tat). In Ravenna waren ganz gewiss nicht die Erben des Arius (die „Arianer“) tätig, sondern Christenmenschen auf der theologischen Basis eines milden reichskirchlichen Kompromisses, die wir nach ihrem zentralen Schlagwort „Homöer“ nennen. Ein Zeichen der Sensibilität, mit der Kermani Kunst beobachtet, ist es aber, wenn er im Ergebnis zu genau der Einsicht kommt, zu der auf Basis solcher neueren christentumsgeschichtlichen Sichtweisen die Fachwelt inzwischen tendiert: Es führen tatsächlich keine direkten Linien vom sogenannten „orthodoxen“ Christentum einerseits und vom sogenannten „arianischen“, eigentlich „homöischen“ Christentum zu bestimmten Christusbildern in den ravennatischen Mosaiken (so auch Kermani, 89). Mindestens eine ausführliche Debatte hat der durch Kermani aufgegriffene Versuch von Michael F. Cusato verdient, den „Brief an Leo“, die im Dom von Spoleto aufbewahrte berühmte Chartula, die Franz von Assisi kurz nach seinem Rückzug auf den Berg Alverna im September 1224 verfasst haben soll, als Segen für den Sultan al-Malik al-Kamil zu interpretieren (274–290). Denn man müsste sich dann zunächst einmal mit Bedenken gegen die Echtheit dieses erst seit 1604 bezeugten mutmaßlichen Autografen auseinandersetzen. Wenn man das Blatt für echt halten will, bleibt die Frage, ob tatsächlich die unbeholfene Zeichnung eines bärtigen Mannes, aus dessen Mund das Tau-Kreuz hervorwächst, den Sultan darstellt (so Cusato), oder nicht doch in traditioneller christlicher Ikonografie den Schädel Adams, mit dem sich der mit Kapuze bekleidete Franz in seiner Selbststilisierung als stigmatisierter alter Christus identifiziert, zugleich erster und zweiter Adam.
Alle solche Einwände wischt Kermani vom Tisch, wenn er im vorletzten Satz seines Buches schreibt: „Nicht nur ist mein Buch an der geglaubten und auch ästhetischen Wahrheit meist mehr interessiert als an dem, was heute für historisch wahr gehalten wird; es ist selbst Ausdruck eines religiösen und ästhetischen Erlebens.“ Insbesondere über diesen Satz würde man gern mit dem hochgebildeten und nicht nur für die Sprache sensiblen Autor weiter diskutieren, dem man über seine für das Buch so konstitutiven katholischen Freunde hinaus auch noch einen evangelischen Freund wünscht, der ihm die Wahrheit dieser Form christlichen Glaubens vielleicht etwas näher bringen könnte, mindestens aber diese Form, die eben nicht in der reinen Formlosigkeit besteht. Denn höchste Freiheit fällt ganz dialektisch mit selbstgewählter Bindung zusammen. Was man übrigens nicht nur bei Luther oder Bonhoeffer lesen kann, sondern auch bei Kirchenvätern wie Ambrosius: Christo servire libertas est
Christoph Markschies (Berlin)