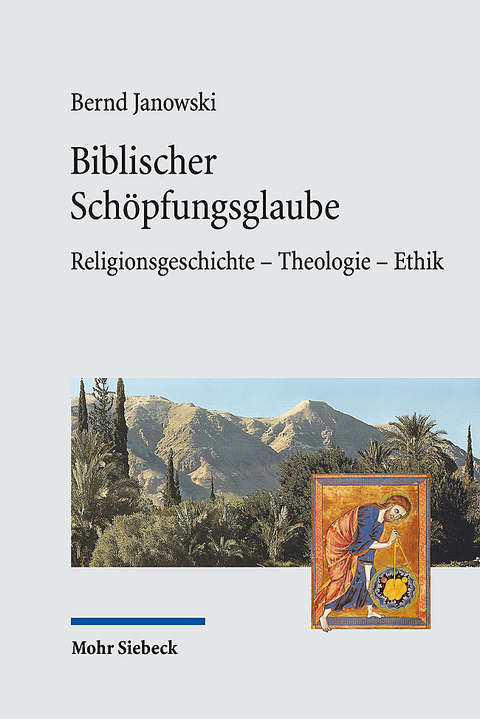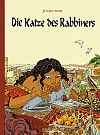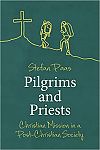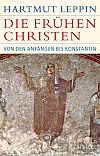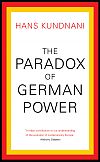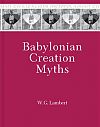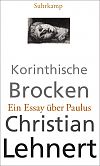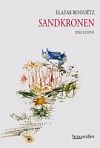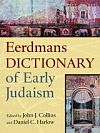Buch des Monats: Januar 2014
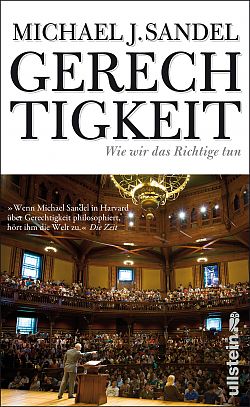
Michael J. Sandel, Aus dem Amerik. v. H. Reuter.
Gerechtigkeit. Wie wir das Richtige tun
Berlin: Ullstein 2013. 413 S. Geb. EUR 21,99. ISBN 978-3-550-08009-8.
Der seit 1980 in Harvard Politische Philosophie lehrende Michael J. Sandel ist spätestens seit seinem 2012 erschienenen Buch »Was man für Geld nicht kaufen kann. Die moralischen Grenzen des Marktes« (vgl. die Besprechung von Wolfgang Erich Müller in ThLZ 138 [2013], 735 f.) auch in Deutschland einer der bekanntesten Moralphilosophen. Vor allem das Thema »Gerechtigkeit« und seine sehr anschauliche Art, höchst diffizile ethische Dilemmata von allen Seiten zu beleuchten, haben ihn weltweit populär gemacht. Auch im hier möglichst vielen Lesern und Leserinnen empfohlenen Buch führt Sandel – oft in juristischer Argumentationsmanier – eine Vielzahl von aus dem Leben gegriffenen Fallbeispielen vor. Seine Ausführungen sind infolgedessen immer an konkrete Geschehnisse rückgebunden, was gewiss ein Hauptgrund für den Erfolg seiner Vorlesungen und Bücher ist.
Sandel geht davon aus, dass menschliche Moralvorstellungen nicht ein für alle Mal »durch Erziehung und Glauben« feststehen, sondern dass vernunftgeleitete moralische Überzeugungsarbeit möglich ist (vgl. 42). Er hat an dieser Stelle die teils stark ideologisch gefärbten religiösen Grabenkämpfe seines US-amerikanischen Kontextes vor Augen. Das Thema seines Buches beschreibt er folgendermaßen: »Wie also können wir mit unserer Vernunft so erfolgreich durch das umstrittene Terrain navigieren, in dem es um Fragen der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Gleichheit und Ungleichheit, die Rechte des Einzelnen und das Allgemeinwohl geht?« (43)
Nach einem Einführungskapitel bringt das zweite Kapitel eine Kritik des Utilitarismus, ausgehend von Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Sandel setzt mit dem berühmten Fall von 1884 ein, bei dem drei Schiffbrüchige überlebten, weil sie den eh schon kranken Schiffsjungen Richard Parker nach acht Tagen ohne jede Nahrung töteten und sich von ihm ernährten. Das ist extrem, aber Sandel zeigt die Grundfrage auf, die auch uns heute betrifft: Darf man einen Menschen töten, um mehrere andere zu retten? Hängt die Rechtfertigung des einen Mordes an der Zahl derer, die dadurch gerettet werden könnten? Würden wir den Abschuss eines von Terroristen gekaperten Flugzeugs nur deshalb akzeptieren, um andere Menschen zu retten, weil wir nicht mit eigener Hand töten müssten und uns das weniger unappetitlich vorkäme als Kannibalismus? Sandel gibt auf solche Fragen keine einfachen Antworten. Aber er legt nahe, dass wir uns »moralisch gesehen nicht ausschließlich um die Konsequenzen einer Handlung sorgen« dürfen, »weil unser Sozialleben durch unbedingt zu respektierende Pflichten und Rechte gekennzeichnet sein sollte« (50). Warum es das sein sollte, beantwortet Sandel jedoch letztlich nicht; er weiß, dass rationalen Argumente dafür stets wieder Gefahr laufen, utilitaristisch zu sein.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Libertarianismus und kritisiert Ansätze von Friedrich A. Hayek, Milton Friedman und Robert Nozick. Sein Untertitel lautet: »Besitzen wir uns selbst?« Dieser Teil des Buches ist ein schönes Beispiel für Sandels Vorgehensweise, moralische Dilemmata aufzuzeigen, indem bestimmte moralische Ansätze bis zur letzten Konsequenz ausgezogen werden. Er verhandelt verschiedene Probleme und endet bei der Frage nach dem Erlaubtsein von Sterbehilfe. Letztere lehnt er nicht grundsätzlich ab, wenn sie aus Gründen der Würde und des Mitleids geschieht, weist aber die libertarianische Begründung zurück, die vom »Selbsteigentum« des menschlichen Körpers und Lebens ausgeht, weil dann auch einvernehmlicher Kannibalismus gestattet werden müsste.
Nachdem Sandel in Kapitel 4 die Frage verhandelt, ob es »Tugenden und höhere Werte« gibt, »die von den Märkten nicht gewürdigt werden und die für Geld nicht zu kaufen sind« (143), befasst sich Kapitel 5 mit Immanuel Kant und dessen Vorstellung von einem »Gesellschaftsvertrag«. Sandel hebt hervor, dass es für Kant ein »Gebot der Gerechtigkeit« ist, die Menschenrechte ausnahmslos allen Personen zu gewähren, einfach deshalb, »weil sie der Vernunft fähige Menschen sind« (170). Gleichzeitig bereitet Sandel mit diesem Kapitel die anschließende Auseinandersetzung mit John Rawls vor (Kapitel 6), der 1971 in »Eine Theorie der Gerechtigkeit« vorgeschlagen hatte, uns zur Bestimmung der Grundsätze unseres Zusammenlebens zu fragen, »welchen Grundsätzen wir in einem [gedachten] Urzustand der Gleichheit zustimmen würden« (193). Es ist inzwischen hinreichend bekannt, dass und warum Sandel den Ansatz Rawls’ als irreal ablehnt. Er gesteht jedoch zu, dass Rawls’ Theorie den »bislang überzeugendsten Versuch der politischen Philosophie in Amerika« repräsentiert, »eine weitgehend egalitäre Gesellschaft zu denken« (227).
Folgerichtig schließt sich das siebente Kapitel an mit Fällen, in denen versucht wurde, bestehende Ungleichheit durch »positive Diskriminierung« auszugleichen. Sandel charakteri-siert am Ende dieses Teils die Philosophien von Kant und Rawls als »kühne Versuche«, eine Grundlage für Recht und Gerechtigkeit zu finden, die neutral ist im Blick auf konkurrierende Visionen vom guten Leben, und will nun überprüfen, »ob ihr Projekt erfolgreich« ist (250). Dafür geht er in Kapitel 8 auf Aristoteles zurück, demzufolge es das Ziel der Politik sein müsse, die Bürger zu ertüchtigen, »ihre spezifischen menschlichen Fähigkeiten und Tugenden zu entwickeln – über das Gemeinwohl zu verhandeln, praktisches Urteilsvermögen zu erwerben, an der Selbstverwaltung teilzunehmen und sich um das Schicksal der Gemeinschaft insgesamt zu kümmern« (264). In dieser Linie steht, was Sandel selbst als Ziel von Politik wünscht und hofft, denn er bezweifelt, dass es möglich ist, etwas als »gerecht« auszugeben, »ohne über die Natur des guten Lebens zu streiten« (282). So fragt das 9. Kapitel »Loyalitätskonflikte« danach, was wir einander schuldig sind. Sandel kommt hier auf Aristoteles zurück und gibt zu bedenken, dass das in unseren demokratischen Gesellschaften verbreitete Streben nach Neutralität ein Irrtum sein könnte – dann nämlich, wenn »zum Nachdenken über das, was für mich gut ist, auch gehört, dass ich über das Gute jener Gemeinschaft nachdenke, an die meine Identität gebunden ist« (332). Zu Recht hebt Sandel hervor, dass eine »von substantiellem moralischem Engagement befreite Politik« zur Verarmung des öffentlichen Lebens führt und eine Aufforderung zu intolerantem Moralismus ist: »Wo Liberale Angst haben, sich zu zeigen, eilen Fundamentalisten herbei.« (333) Das 10. Kapitel »Gerechtigkeit und Gemeinwohl« bündelt den umfänglichen und durch die vielen Fallbeispiele zwar anschaulichen, aber gelegentlich auch etwas verwickelten Argumentationsgang.
Insgesamt erweist sich Sandel mit diesem Buch einmal mehr als maßvoller, aber entschiedener Kritiker des philosophischen Liberalismus. Von seinem kommunitaristischen Ansatz her steht er u. a. er in einer Linie mit Charles Taylor. Sandel will den Menschen nicht einfach als Konsumenten verstanden wissen, sondern als Teil einer Zivilgesellschaft. Dafür dürfe man die Begründung von Freiheitsrechten nicht von bestimmten Wertorientierungen und Vorstellungen davon, was gut ist, trennen. Auch wenn Sandel selbst keine explizit religiösen Argumentationsmuster nutzt, auch dann nicht, wenn sie seinen eigenen Überzeugungen nahelägen, ist er der Überzeugung, dass die persönlichen moralischen und religiösen Überzeugungen der Menschen in der öffentlichen Debatte zu Recht und Gerechtigkeit zum Tragen kommen müssen. Damit steht er im Gegensatz zu Rawls, der die Identität als Staatsbürger von der Identität als moralische Person getrennt wissen will, um einen »vernünftigen Pluralismus« akzeptieren zu können (vgl. 339/340). Sandel sieht darin eine »Aushöhlung des öffentlichen Raums«, die es erschwere, »die Solidarität und den Gemeinschaftssinn zu pflegen, von denen eine demokratische Zivilgesellschaft abhängt« (365). Er plädiert für eine »robustere« Diskussionskultur: »Anstatt den moralischen und religiösen Überzeugungen aus dem Weg zu gehen, die von unseren Mitbürgern ins öffentliche Leben eingebracht werden, sollten wir uns eher direkt mit ihnen beschäftigen – sie also manchmal in Frage stellen oder bestreiten und gelegentlich auch von ihnen lernen.« (367)
Das ist nicht nur für die US-amerikanische Diskussionskultur zu wünschen, sondern auch für die deutsche. Voraussetzung dafür sind unideologisch geführte Debatten, deren erstes Ziel nicht darin besteht, Recht zu haben und den Gegner moralisch zu disqualifizieren, sondern ständig neu auszuhandeln, was unsere Demokratie stärkt und für alle ihre Glieder ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Im Interesse dieses Zieles schult Sandel die Urteilskraft seiner Leser.
Annette Weidhas (Leipzig)