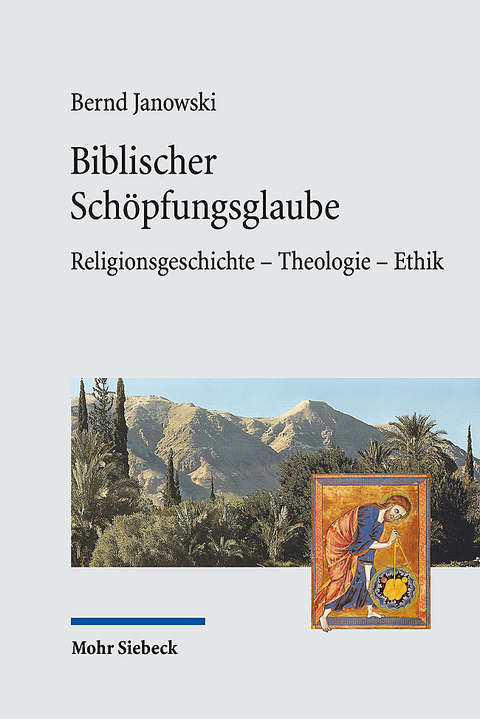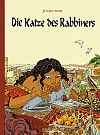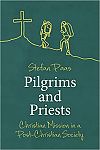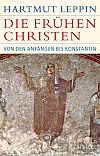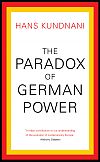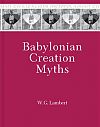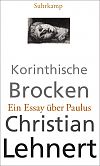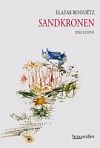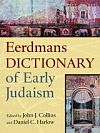Book of the month: May 2021
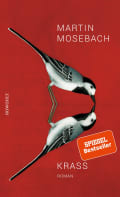
Mosebach, Martin
Krass
Hamburg: Rowohlt 2021. 525 S. Geb. EUR 25,00. ISBN 978-3-498-04541-8.
Der neue, im Februar 2021 erschienene Roman von Martin Mosebach hat vordergründig nur am Rande mit Religion zu tun – außer man begreift, dass, wenn es um den Menschen geht, es immer auch um das geht, was Menschen glauben, lieben und hoffen. Noch weniger geht es Mosebach um Politik, außer man versteht, dass die ausschließliche Konzentration auf das menschliche Dasein in allen erdenklichen Lebensvollzügen, eben dadurch hochpolitisch ist. Auch erfährt man nur am Rande da und dort Näheres über Herkünfte und Hintergründe der Figuren, die das Buch eindrucksvoll gezeichnet bevölkern. Sie bilden ein Panoptikum, das gut zur Vorstellung eines Zauberkünstlers passt, mit der die Handlung einsetzt.
Mosebachs Typen wirken überzeichnet, ordnen sich aber nach und nach ein in das, was alle Menschen zeichnet: die Unfähigkeit, von sich selbst abzusehen und anderen liebend gerecht zu werden, ja sie auf Dauer auch nur zu ertragen. Keiner der Mitspieler – gleich ob Mann oder Frau – hat eine »gelingende« Beziehung. Und von den schnäbelnden Vögelchen auf dem Schutzumschlag wird berichtet, dass das grüne Wellensittichmännchen nach Jahren unauffälligen käfigsicheren Zusammenlebens seine Dame grausam totgehackt hat. Ist das Tier schuldig? Ist es der Mensch? Mosebach geht es nicht um Moral, sondern um die physisch-psychische Konstitution des Menschseins – universal, alle Kulturen und Religionen übergreifend. Ein einziges Trauerspiel ist der Roman jedoch nicht. Mosebachs Figuren tanzen auf dem Vulkan ihrer Wünsche, Hoffnungen und Begierden, was der Erzähler nüchtern-freundlich, manchmal auch schalkhaft, beobachtet. Mosebachs Sprache hat dabei nichts Geziertes und Gewolltes, sie ist einfach nur schön und trifft mit jedem Wort.
Der Titelheld Ralph Krass ist alles andere als ein Sympathieträger. In den Augen seiner Mitheldin Lidewine Schoonemaker ist er aber gar nicht allzu krass, sie nennt ihn »Krasslein«. Und am Ende wird ihm, der gerne ein Alexander der Große oder Napoleon gewesen wäre, auch nicht wie seinem Namensgeber Marcus Licinius Crassus der Kopf abgeschlagen. Krass ist einfach nur ähnlich fett und wie der alte Römer der Selbstüberschät¬zung erlegen. Recht prosaisch verscheidet er in einem Kairoer Armenkrankenhaus nach einem Infarkt. Immerhin, dank eines letzten Menschen, den er für sich hatte einnehmen können, auf sauberen Laken. Sein – nun doch todtrauriges – Fallen ins Nichts ist so ziemlich die eindrücklichste Beschreibung eines Sterbens, die ich je gelesen habe: »Nebel. In undurchdringlichen Schwaden, in leichten Wolken bewegt, den hatte er zu durchqueren. Aber nun wurde klar, daß diese Nebel von einem ungeheuren Wasserfall erzeugt wurden, der von solcher Höhe herabstürzte, daß sich die Fluten in Tröpfchen auflösten, als Kaskade gar nicht mehr erkennbar – ein Wolkenleib, der die Gewalt, die ihn hervorbrachte, nur ahnen ließ. ... Und dann, schon sehr nah an den kreisenden Wassern im Licht, ein Nachlassen der Kraft, die ihn emporhob, und es gab keine eigene Kraft, sie zu ersetzen – das hieß Stürzen, ein Fallen hinab, während die Himmelsfluten immer kleiner wurden, hinab durch weite Räume ohne ein anderes Ziel als das immer dichter anwachsende Dunkel, die Nacht.« (514 f.) Krass, der Kämpfer, verliert auch den allerletzten Kampf und stürzt ab ins Reich des Todes. Ob Gott ihn von dort zu sich emporheben wird, bleibt offen.
Wie aber kam es zu diesem Tod, vor dem ja ein Leben war? Krass, in Berlin geboren und kurz vor Kriegsende zehn Jahre alt, ist ein Glücksritter, der sich gern als »Kaufmann« bezeichnet, aber mit allem und jedem Geschäfte macht. Zum Schluss ist er ein Waffenhändler, der dem orientalischen Typos seinesgleichen, dem General Habob, nicht gewachsen ist. Krass, ein »stattlicher« Mann, verschlingt Unmengen an teuren Speisen, und der Alkohol geht nie aus. Er hat gelernt, die Leute schon mit seiner Physis zu beherrschen. »Es zählte nur das physische Gegenüber – die Augen, die Stimme, die erotische Wucht eines schweren gesunden Körpers, unter dessen gepflegter Haut sich ein immenses Kraftreservoir verbarg.« (364) Hinzu kommt bei dem an sich »Ungebildeten« eine Art grausamer psychologischer Instinkt. Seinen Mangel an Wissen macht er wett durch bedeutungsvolles Schweigen, in das alle alles hineinlegen können. Er manipuliert erfolgreich Menschen, indem er sie glauben macht, seine physisch-psychische Gewaltsamkeit sei Gewaltigkeit. Und er kauft seine Entourage auch ganz schnöde mit Geld, solange er es hat. Ist das krass? Nein, so funktioniert die Welt.
Gekauft hat er auch Doktor Jüngel, einen arbeitslosen Akademiker, mit Vornamen Matthias. Allerdings macht der diesem Namen – »Geschenk Gottes« – wenig Ehre. Jüngel, inzwischen kein Jüngling mehr, ist im Gegensatz zum barocken Krass ein gebildetes Jüngelchen: schmal, dienstbeflissen, geizig. Erschrickt er, beschlägt seine Brille. Während Krass selbst die gedemütigten Frauen anhängen, wenn auch, wie die eigene, nicht ewig, hat Jüngel nie bleibenden Erfolg bei ihnen. Er ist der Gegenpart zu Krass, dem der Roman in dieser Funktion mindestens ebenso viel Platz einräumt wie dem Titelhelden. Streng genommen, sogar mehr. Mit Jüngel beginnt die Geschichte auf der zweiten Seite, mit ihm endet sie auf der letzten, das zweite Kapitel dominiert er. Doch der Reihe nach: Krass, der nicht allein sein will, verbindliche Zweisamkeit aber scheut, sammelt in Neapel, wo er mit seinem »Geschäftspartner« Levcius zu tun hat, eine Gesellschaft um sich, die unterhalten sein will. Dafür, quasi als Touristenführer, sowie als Exekutor seiner Menschenexperimente engagiert Krass den guten Jüngel. Der ist ob der enorm großzügigen Bezahlung ganz aus dem Häuschen und will alles seinem Herrn recht machen. Eines Tages begegnet die Gesellschaft Lidewine Schoonemaker beim Essen in einem Nobelhotel. Dort sitzt sie, obwohl sie den bestellten Champagner gar nicht bezahlen könnte, aber man weiß ja nie. Und siehe da – Krassens Blick fällt auf sie. Flugs wird Jüngel beauftragt, ihr einen Kontrakt als Begleiterin von Krass anzubieten. Der Kontrakt enthält aber die Klausel, dass Lidewine während der Laufzeit des Vertrags keine amourösen Abenteuer eingehen darf, obwohl Krass selbst sich Abstand ausbittet und nicht intim werden möchte. Die junge Frau sagt sofort zu und die Sache nimmt ihren Lauf. Als Verwalter über den unerschöpflichen Geldkoffer von Herrn Krass geht Jüngel mit ihr zum Einkaufen – Kleider, Parfüm und Perlen vom Feinsten. Und in der Tat: Wenn die mit ihrem quadratischen Gesicht zwar nicht direkt hübsche, aber mit ihrer Figur und ihrer Haarpracht beindruckende Lidewine ihre marmorfesten Beine so aus dem Taxi gleiten lässt, dass in der Spannung auf den Rest alle Gespräche der Wartenden verstummen, hat Krass, was er wollte. Leider nur kann Lidewine einem feurigen schwarzgelockten Kellner nicht widerstehen.
Damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Zu Jüngels Aufgaben gehört es, die gekaufte Frau zu überwachen und Meldung zu erstatten, sollte sie den Vertrag brechen. Selbst Lidewines Attraktion nicht abgeneigt, beobachtet Jüngel eines Nachts, wie der Kellner sich in ihr Zimmer schleicht. Von Eifersucht und Diensteifer gleichermaßen gedrängt, verrät er sie umgehend. Die Erläuterung des Mosebachschen Erzählers liest sich wie folgt: »Selten sind im Leben eines Geistesmenschen die Augenblicke, in denen er handeln und etwas bewirken darf. Sonst verachtete er mit geheimem Groll die Plumpheit der Tatmenschen und fühlte doch peinlich die eigene Schwäche. Wie gut es tat, jetzt einmal zur Schadenfreude berechtigt zu sein!« (186) Krass befiehlt Jüngel, die Frau sofort zu entfernen. Die Worte, mit denen er das tut, werden so kommentiert: QDas alles war in eisiger Korrektheit ausgesprochen, ein kommunistischer Kommissar, welcher der Zarenfamilie den Befehl überbringt, sich für die Deportation bereitzuhalten, hätte nicht unnahbarer sein können.« (188) Das ist die einzige Stelle, an der Mosebach aus dem Rahmen des zwar klar sehenden, aber nicht (ver)urteilenden Beobachters herausfällt. Krass ist ein Bösewicht, schon klar. Aber dieser Jüngel ist ein Scherge. In Form leiser Intellektuellenkritik taucht das Missvergnügen an dieser Gestalt später erneut auf, wenn erzählt wird, dass Jüngel sich als Herausgeber von Aufsätzen anderer Leute am wohlsten fühle, da eigene Buchprojekte stets mit schmerzhaften Geburtswehen verbunden seien (420).
Krass nun hat zwar Lidewine verstoßen, verzeiht aber die Denunziation nicht. Jüngel muss ebenfalls gehen, ohne das versprochene Salär zu erhalten. Der Kreis löst sich auf. Damit endet der erste Teil des Romans »Allegro imbarazzante« rasch und peinlich für alle Beteiligten. Der zweite Teil, »Andante pensieroso«, scheint gemessen nachdenklich Anteil am nicht nur unseligen, sondern auch unglücklichen Jüngel nehmen zu wollen. Der hat nicht nur Krass verloren, auch seine Frau Hella gibt ihm den Laufpass. Sie verachtet ihn nicht nur ob seiner unerotischen Erfolglosigkeit, sondern hat inzwischen bemerkt, dass sie nichts mit ihm verbindet, das ihr wichtig ist. Der schwer liebeskranke Jüngel zieht sich daraufhin ins Ferienhaus eines Freundes zurück. Dort, in einem abgelegenen französischen Provinzort, schließt er Bekanntschaft mit einem Schuster, einer ehrlichen, einfachen Haut, dessen Frau ihn verlassen hat, weil sie nach Höherem strebte. Es stellt sich irgendwann heraus, dass die ehemalige Schusterfrau inzwischen die Gattin eines der Satelliten ist, die im vorigen Kapitel um Krass kreisten. Immerhin erkannte sie, dass Lidewine die einzig Unabhängige der Gesellschaft war, was sie ihr zum Abschied auch sagt. Ihr erster Mann, der Schuster Desfosses, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als die einzig wirklich sympathische Gestalt. Das sieht auch Jüngel so, der dem Schuster zubilligt, »dass die Reinheit des Herzens keine Scheu vor dem Klischee kennt – alle Menschen sind gleich und haben dieselben Erfahrungen« (299). Letztlich aber lernt Jüngel nicht von ihm. Er weiß nicht aus noch ein und versucht von Krass das ihm seiner Meinung nach noch zustehende Geld zu erlangen. Doch Krass bleibt unzugänglich und rät ihm, sein Leben aus eigener Kraft auf die Reihe zu bringen. Und siehe da, irgendwie schafft Jüngel es, sich zu den Erfolgreichen zu gesellen. Wie, das bleibt verborgen. Mosebach verzichtet, wie in moderner Literatur weithin üblich, oft auf das Erzählen stringenter Handlungszusammenhänge. Das ist manchmal als Stilmittel sinnvoll, aber gelegentlich auch schade. Menschen wollen erzählt bekommen.
Im dritten Teil, »Marcia funebre« (Trauermarsch), ist Jüngel – 20 Jahre später, wir sind im Jahr 2008 – längst Professor, Inhaber eines Lehrstuhls für Urbanistik. Aus dienstlichen Gründen hat es ihn nach Kairo verschlagen. Weil alles mit allem irgendwie zusammenhängt, mietet er das Zimmer, aus dem der bankrotte Krass gerade herausgeworfen wurde. Krass ist in jeder Hinsicht am Ende. In dieser Situation gabelt er beim ziellosen Durchstreifen der Stadt in einem Lokal einen jüngeren Rechtsanwalt namens Mohammed auf – einen grobschlächtigen, bäuerischen Typen aus dem Nildelta. Mohammed ist beeindruck von dem scheinbar immer noch kraftstrotzenden Deutschen. Er nimmt Krass an Vaters statt an und sorgt auch dann für ihn, als er schwächer wird. Mohammed ist fromm, wenn auch nicht fehlerfrei, und betont gern seine »moralischen Werte«. Sein Selbstlob kommt naiv daher, kindlich fast. Humor versteht er nicht, Sarkasmus gleich gar nicht. Vieles dessen, was Mohammed tut und sagt, passt Krass überhaupt nicht. Früher hätte er derlei brüsk zurückgewiesen, nun ist er abhängig von diesem Menschen. Also schluckt er neue Ansichten. Bisher war er der Meinung, dass Selbsttötung – wie bei den Germanen oder antiken Heroen –notfalls Ausdruck höchster Freiheit sei. Für Mohammed aber ist sie größte Gottvergessenheit. Auch gut. Schließlich will Krass sich sowieso nicht umbringen, sondern im Gegenteil mit Mohammed neu anfangen – voller Stolz, noch einmal »von einer anderen Seele Besitz« ergriffen zu haben, um »ihre Phantasie zu okkupieren, sie in die eigenen geträumten Projekte hineinzuziehen« (478). Daraus wird jedoch nichts. Der Geist ist willig, das Fleisch schwach. Des großen Manipulators massiger Körper muss aufgeben.
Jüngel hingegen ist bei guter Gesundheit. Auch Kummer und Leid setzen ihm nicht mehr zu. Er hat inzwischen eingesehen, dass er nie wird einen Menschen auf Dauer für sich gewinnen können. Darüber ist Jüngel jedoch nicht unglücklich, nein, diese Erkenntnis hat ihn befreit. Geradezu dankbar ist er dafür, »daß am Ende auch ihm die Gabe der Kälte und Rücksichtslosigkeit« geschenkt worden ist, »nicht mehr geliebte Menschen verstoßen zu können«. Er ist aus dem »Heer der Liebeskrankenq ausgetreten und in die »Abteilung der Dreisten und Gesunden befördert worden« (418). Dieser Selbstschutz wird noch einmal kurz aufgebrochen, als er, welch Zufall, Lidewine im Hotel trifft. Die zwar älter gewordene, aber immer noch berückende Frau trägt ihm scheinbar nichts nach. Sie, die Tochter eines erst postum berühmt gewordenen Konzeptkünstlers, ist inzwischen selbst als international agierende Kunstagentin wohlhabend geworden. Und ein weites Herz hatte sie immer schon. Sie liebt Männer, mehr oder weniger alle. Da sie sich nicht festlegen kann – es gibt ja so viel Schönes –, ist sie unbehaust und unverheiratet geblieben. Warum also sollte sie sich nicht auch einmal Jüngel zuwenden? So geschieht es. Doch bestimmt Prägungen ändert sich nicht wirklich, darum auch nicht Jüngels Versagen bei Frauen. Die beiden treffen im Haus einer Künstlerin, deren Werke Lidewine anschauen will, Mohammed. Noch wissen sie nicht, dass der, den dieser vulgär wirkende Mann Vater nennt, Krass ist. Und doch lässt Lidewine Jüngel sofort für Mohammed stehen. Geschlechterkampf ist nicht das kleinste Thema dieses Romans.
An dieser Stelle beginnt das Finale. Mohammed erweist sich als ebenso unbeeinflussbar wie Krass und Lidewine. Diese drei sind keine Intellektuellen, sondern leben, wie es sich ergibt. Die beiden Westler dabei ohne jeden Glauben, der Muslim mit einem scheinbar naturgegebenen. Doch wie auch immer, Professor Jüngel läuft nur noch nebenher. Aber er entdeckt, um wen sich Mohammed im Krankenhaus kümmert. Bald darauf stehen sie zu dritt an Krassens Bett – und finden nur noch einen Toten vor. Krass ist eben abgestürzt in die Unterwelt. Mohammed ist es, der ihm die Augen schließt und kurz danach den Leichnam okkupiert, so dass Jüngel und Lidewine nicht einmal mehr ein Grab finden können. Das Trio zerbricht, jeder steht wieder für sich allein. Nur Mohammed hat einen Vater gewonnen. Der ist zwar nun tot, immerhin aber so rechtzeitig gestorben, dass er ihn nicht mehr enttäuschen konnte. Und: Für Mohammed ist der Tod ein Durchgangsstadium. „Von Gott kommen wir, und zu Gott kehren wir zurück«, sagt er, als er mit steinerner Miene Krass die Augen schließt (517). Der erwählte Vater bleibt ihm; er wartet. Lidewine und Jüngel aber werden nie glauben, erwartet zu werden, weder im Leben noch im Tod, nicht von einem Menschen und nicht von Gott.
Annette Weidhas (Leipzig)